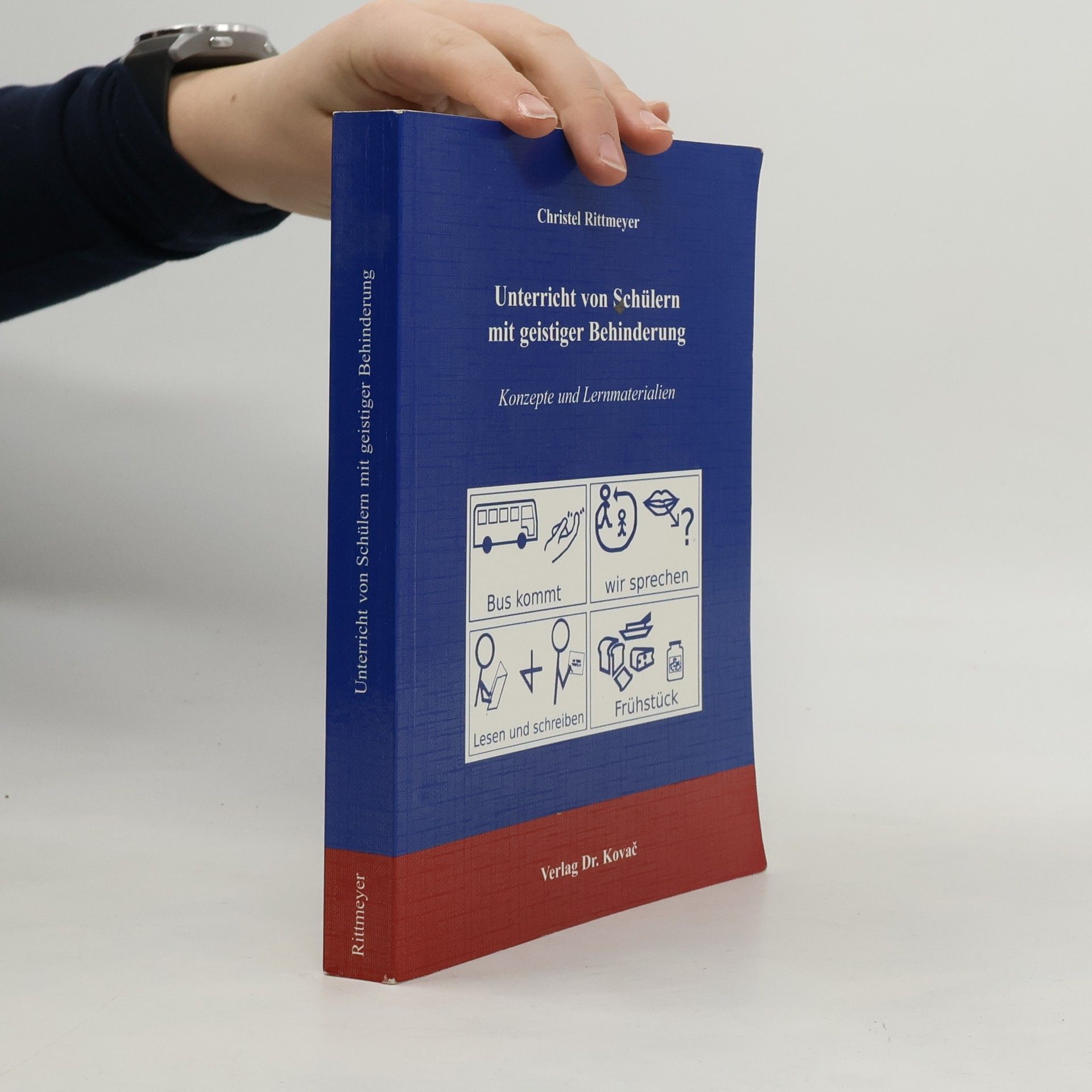Unterricht von Schülern mit geistiger Behinderung
- 388pages
- 14 heures de lecture
Ausgangspunkt des Buches ist die Überlegung, dass Selbstbestimmung im Unterricht bei Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung vor allem durch Selbststeuerung möglich wird und geeignete Lernmaterialien hierfür eine wesentliche Voraussetzung sind. Es werden aktuelle Konzepte des Unterrichts bei Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung und Lernmaterialien sowie deren Herstellung detailliert beschrieben.