'Jugend' ist eine Erfindung der Moderne! Was aber ist das 'Juvenale'? Lassen sich die Vorstellungen über die Entwicklungsphase reduzieren auf psychogenetische Prozesse und die Phänomene individueller Persönlichkeitsbildung? Hat 'Jugend' nicht vielmehr immer auch eine überindividuelle kulturelle Dimension – als Signum ereignishaft eingeschriebener generationaler historischsozialer Erfahrungen? Tatsächlich antizipiert das Bedeutungsfeld gesellschaftliche Idealbilder des Zukünftigen, des Anderen: Das 'Juvenale' verkörpert Hoffnung – 'Jugend' bedeutet, frei zu sein, von den Zumutungen des Konventionellen, frei von der Notwendigkeit, die eigene Existenz durch Erwerbsarbeit sichern zu müssen, frei von Verantwortung und Verpflichtung. Schließlich meint 'Jugend' vor allem auch frei dafür zu sein, Lebensperspektiven – auch riskante, unverantwortliche und existenziell bedrohliche – erkunden zu dürfen. Mit 'Jugend' leistet sich die moderne Gesellschaft ein lebensgeschichtliches Moratorium. Der vorliegende Band dokumentiert und bilanziert die Erträge der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem sozialen Phänomen 'Jugend'. Vor allem werden Einblicke gegeben in aktuelle Perspektiven und künftige Aufgaben einer ambitionierten sozialwissenschaftlichen Jugendforschung.
Jens Brachmann Livres

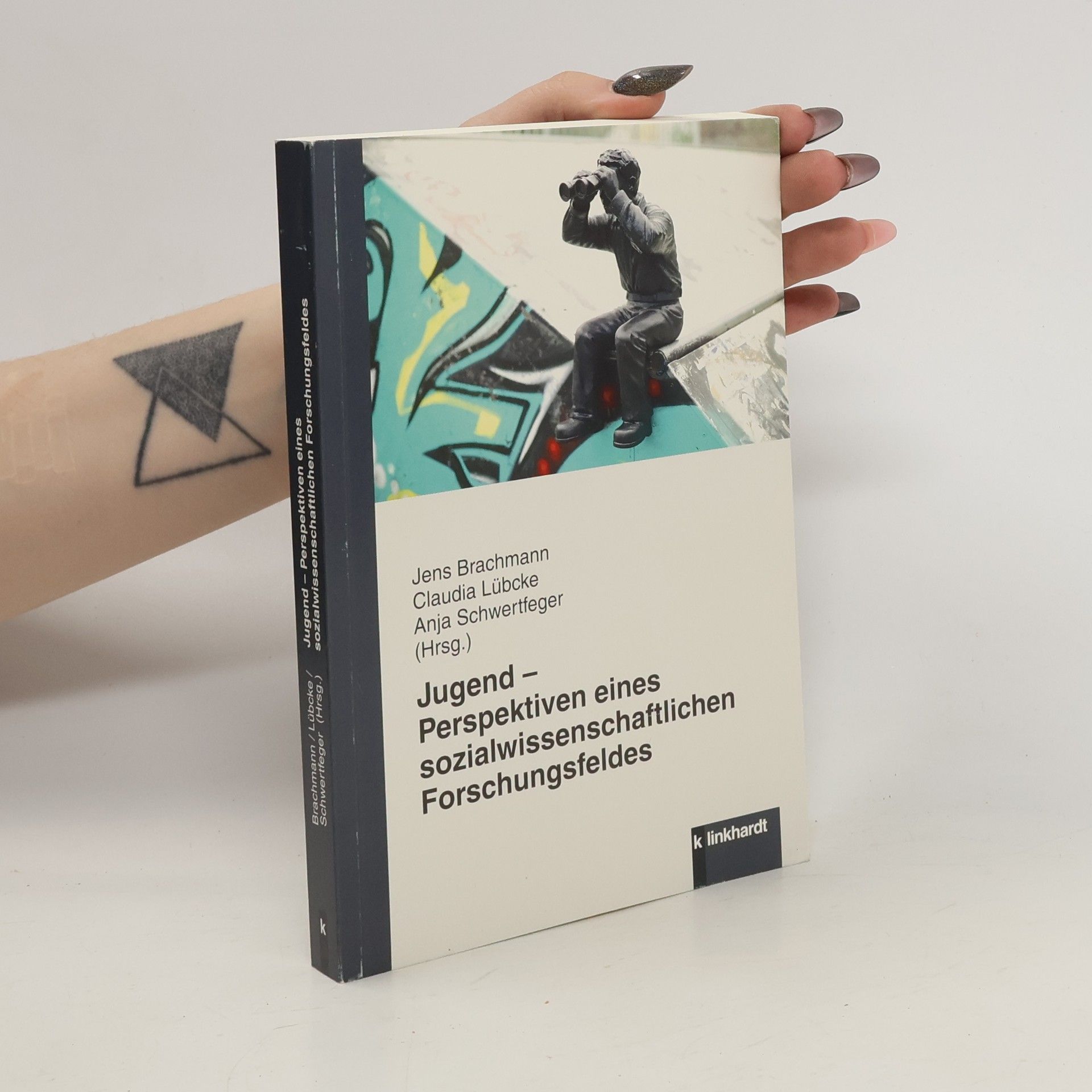
Tatort Odenwaldschule
Das Tätersystem und die diskursive Praxis der Aufarbeitung von Vorkommnissen sexualisierter Gewalt
Pädosexuelle Gewalt ist Ausdruck eines Systemversagens. Tatsächlich bedarf es eines »ganzen Dorfes«, um ein Kind zu missbrauchen. Diesbezüglich bieten gerade Internate und Heime potentiellen Tätern und Täterkollektiven besonders günstige Gelegenheitsstrukturen für Gewalt gegen Schutzbefohlene – organisatorische Defizite, Diffusion der Professionsrollen, Verwerfungen in den Hierarchieebenen. Vor allem aber findet man in den Gremien, in den Kollegien oder im institutionellen Umfeld dieser Einrichtungen Mitwissende, Kollaborateure, schweigende Zeuginnen und Zeugen, aktive wie passive Tatbeteiligte, welche die Übergriffe begünstigen. Auf der Grundlage umfangreicher Quellenstudien und kulturhistorischer Analysen dokumentiert »Tatort Odenwaldschule« die Vorkommnisse in dem einstigen südhessischen Reforminternat als ein erschütterndes Beispiel für eine geschlossene Organisation, in der Heranwachsende seit den 1960er-Jahren hundertfach einem solchen »Tätersystem« ausgeliefert waren.