Winfried Heinemann Livres
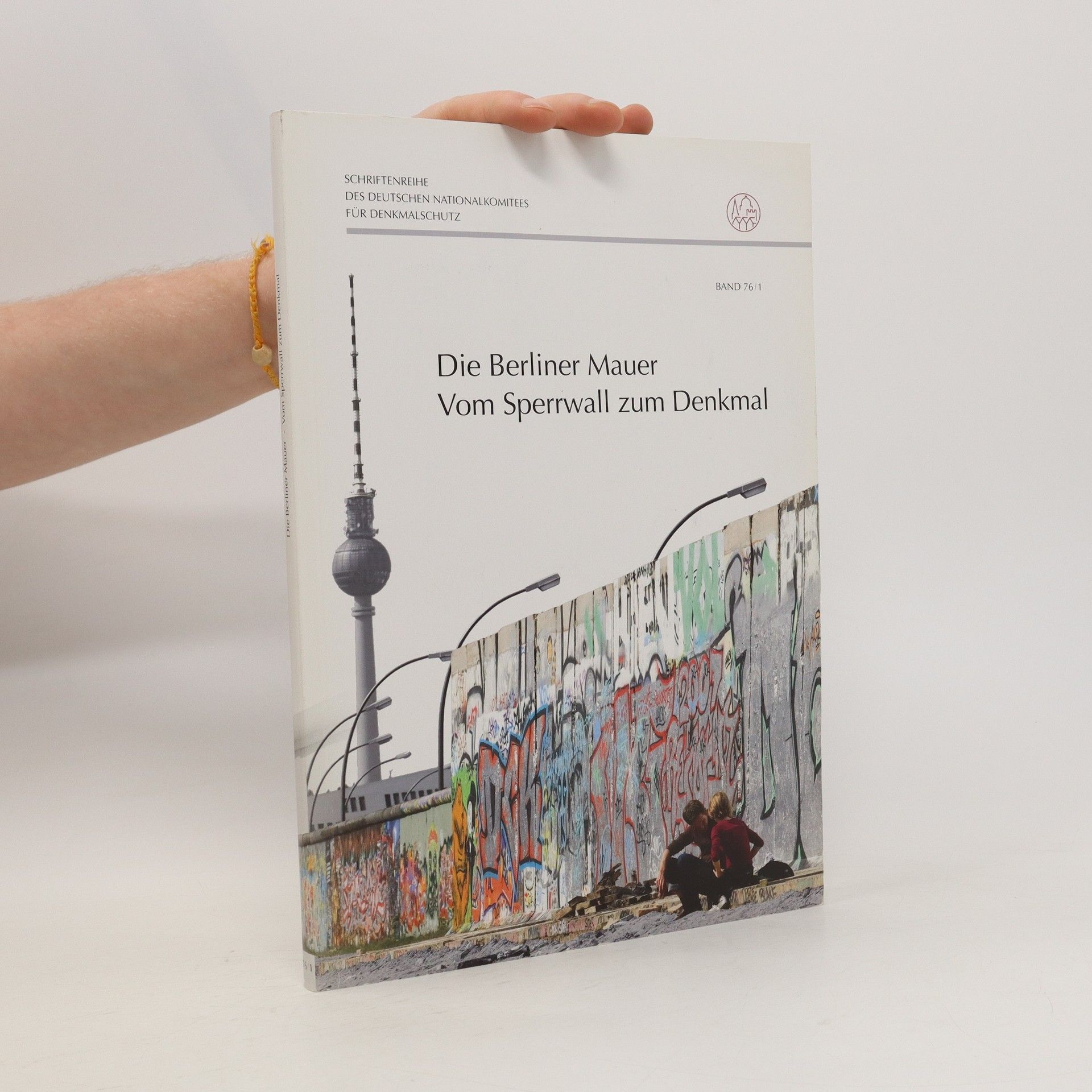


Unternehmen \"Walküre\"
- 416pages
- 15 heures de lecture
Am 20. Juli 1944 verübte ein Offizier ein Attentat auf Hitler. Stauffenberg und andere Heeresoffiziere versuchten, das NS-Regime zu stürzen und den ausweglosen Krieg zu beenden. War es nur ein "Aufstand des Gewissens"? In welcher militärischen Tradition standen die Verschwörer? Und welche militärischen Überlegungen lagen ihrem Handeln zugrunde? Der Band analysiert die Ereignisse aus einer spezifisch militärgeschichtlichen Perspektive und nimmt im Schwerpunkt die militärischen Umsturzplanungen in den Blick. Er fragt aber auch nach den Auswirkungen von Attentat und Staatsstreichversuch auf das Militär der Nachkriegszeit in West- und Ostdeutschland sowie in Österreich. Dass Stauffenberg und seine Mitverschwörer einer anderen Vorstellung von der Rolle des Militärs im Staat anhingen, machte es für die Nachkriegsarmeen nicht einfach, sich in die Tradition des Aufstandes gegen den Krieg und das verbrecherische Regime zu stellen.