Patrick Donges Livres
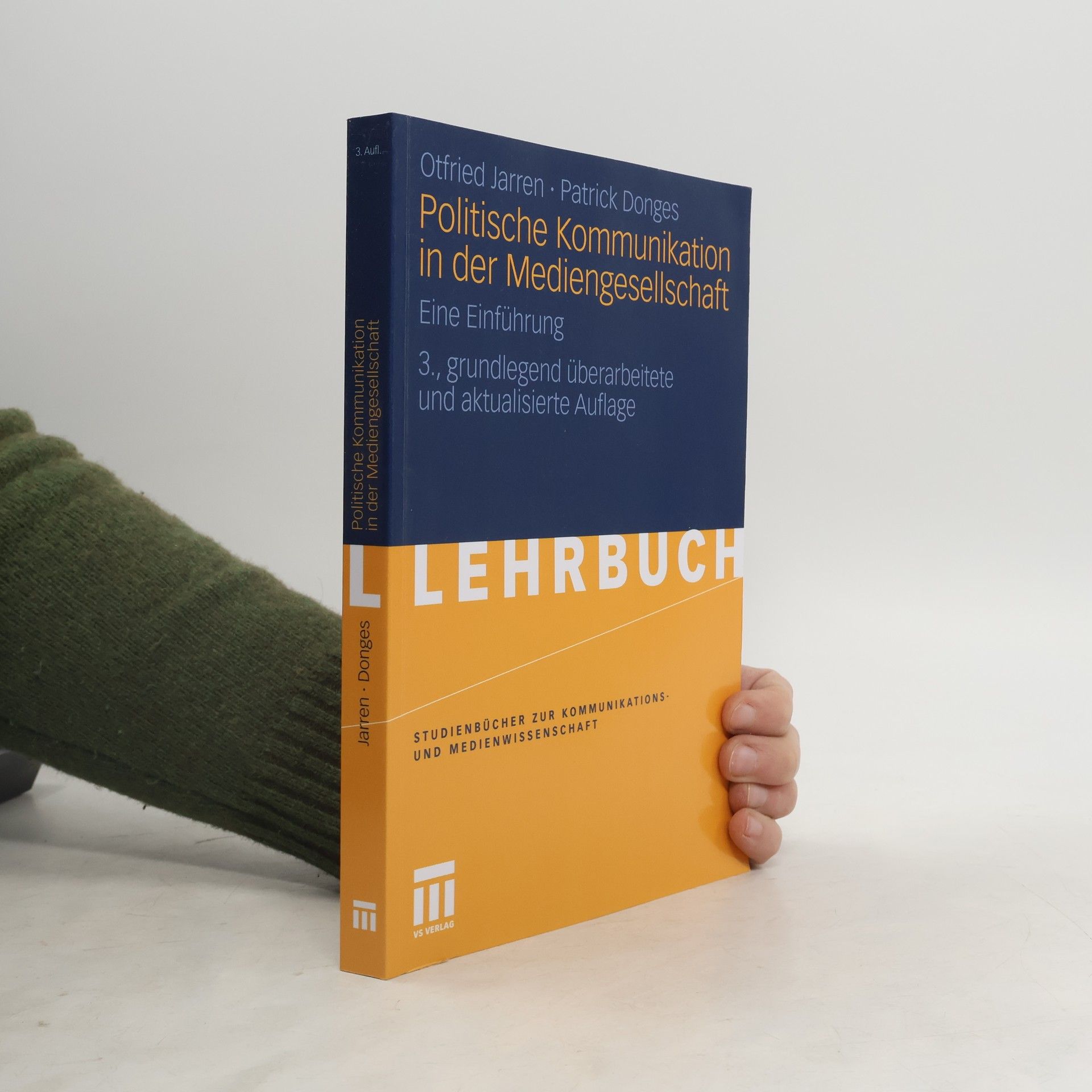

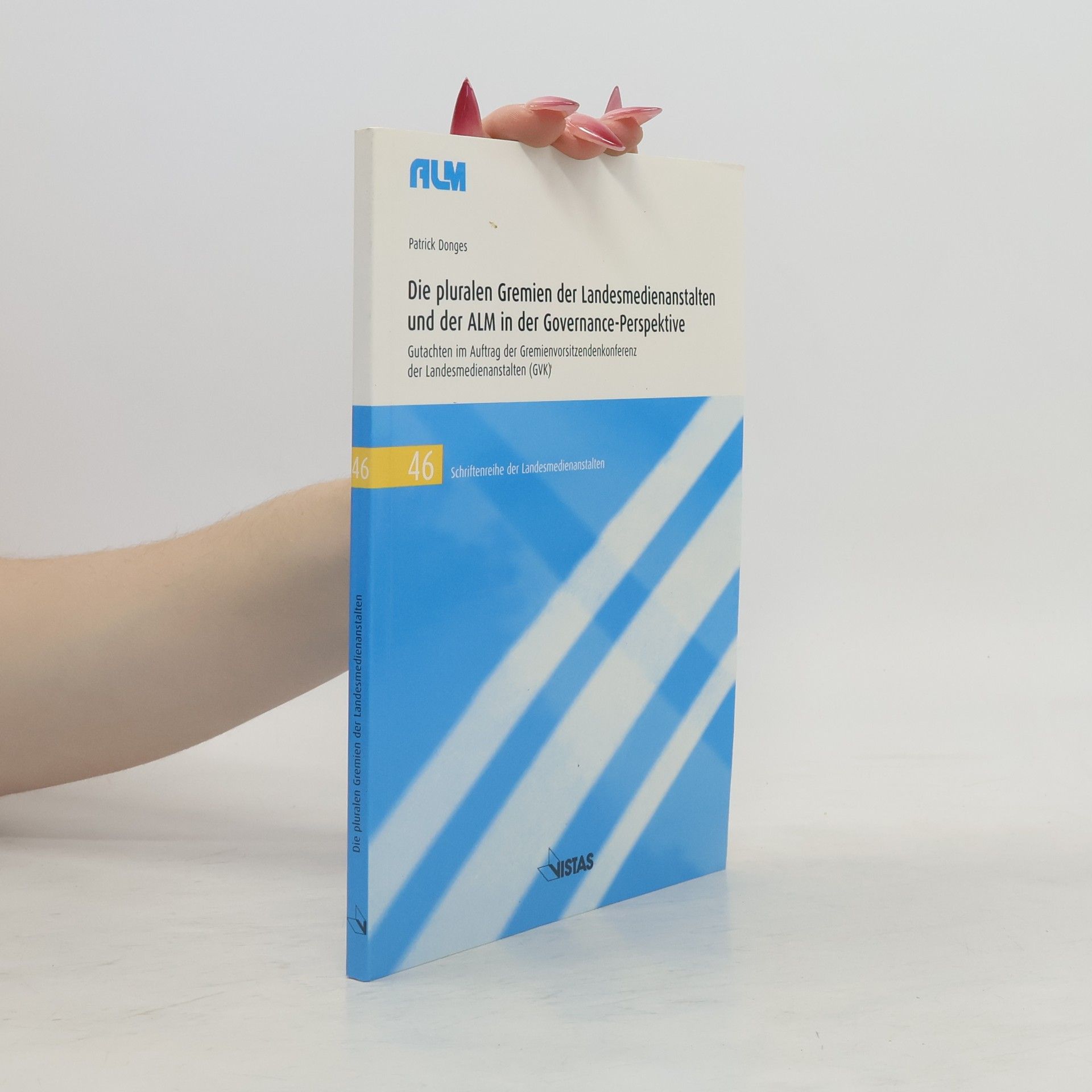
Politische Kommunikation in der Mediengesellschaft
- 215pages
- 8 heures de lecture
Politische Kommunikation in der Mediengesellschaft ist ein komplexer und vielschichtiger Forschungsgegenstand. Das Lehrbuch legt den Schwerpunkt auf die Strukturen, Akteure und Prozesse politischer Kommunikation und analysiert diese aus einer kommunikationswissenschaftlichen Perspektive unter Berücksichtigung der Theorie- und Forschungsbestände anderer Sozialwissenschaften. Politische Medieninhalte werden als das Ergebnis von Interaktionsprozessen verstanden, die im Rahmen von Strukturen der Politik wie der Medien zwischen politischen und medialen Akteuren stattfinden. Dabei wird der Mesoebene der Organisationen wie der Makroebene der Gesellschaft besondere Aufmerksamkeit geschenkt, da politische Kommunikation in erster Linie eine organisierte Form der Kommunikation ist – sowohl auf Seiten der Politik wie auch auf Seiten der Medien. Gegenüber der zweiten Auflage wurde das Lehrbuch grundlegend aktualisiert, gestrafft und neu strukturiert.
Studienbücher zur Kommunikations- und Medienwissenschaft: Politische Kommunikation in der Mediengesellschaft
Eine Einführung - 3., grundlegend überarbeitete und aktualisierte Auflage - Lehrbuch
- 283pages
- 10 heures de lecture
Politische Kommunikation in der Mediengesellschaft ist ein komplexer und vielschichtiger Forschungsgegenstand. Das Lehrbuch legt den Schwerpunkt auf die Strukturen, Akteure und Prozesse politischer Kommunikation und analysiert diese aus einer kommunikationswissenschaftlichen Perspektive unter Berücksichtigung der Theorie- und Forschungsbestände anderer Sozialwissenschaften. Politische Medieninhalte werden als das Ergebnis von Interaktionsprozessen verstanden, die im Rahmen von Strukturen der Politik wie der Medien zwischen politischen und medialen Akteuren stattfinden. Dabei wird der Mesoebene der Organisationen wie der Makroebene der Gesellschaft besondere Aufmerksamkeit geschenkt, da politische Kommunikation in erster Linie eine organisierte Form der Kommunikation ist – sowohl auf Seiten der Politik wie auch auf Seiten der Medien. Gegenüber der zweiten Auflage wurde das Lehrbuch grundlegend aktualisiert, gestrafft und neu strukturiert.