Sabine Holtz Livres




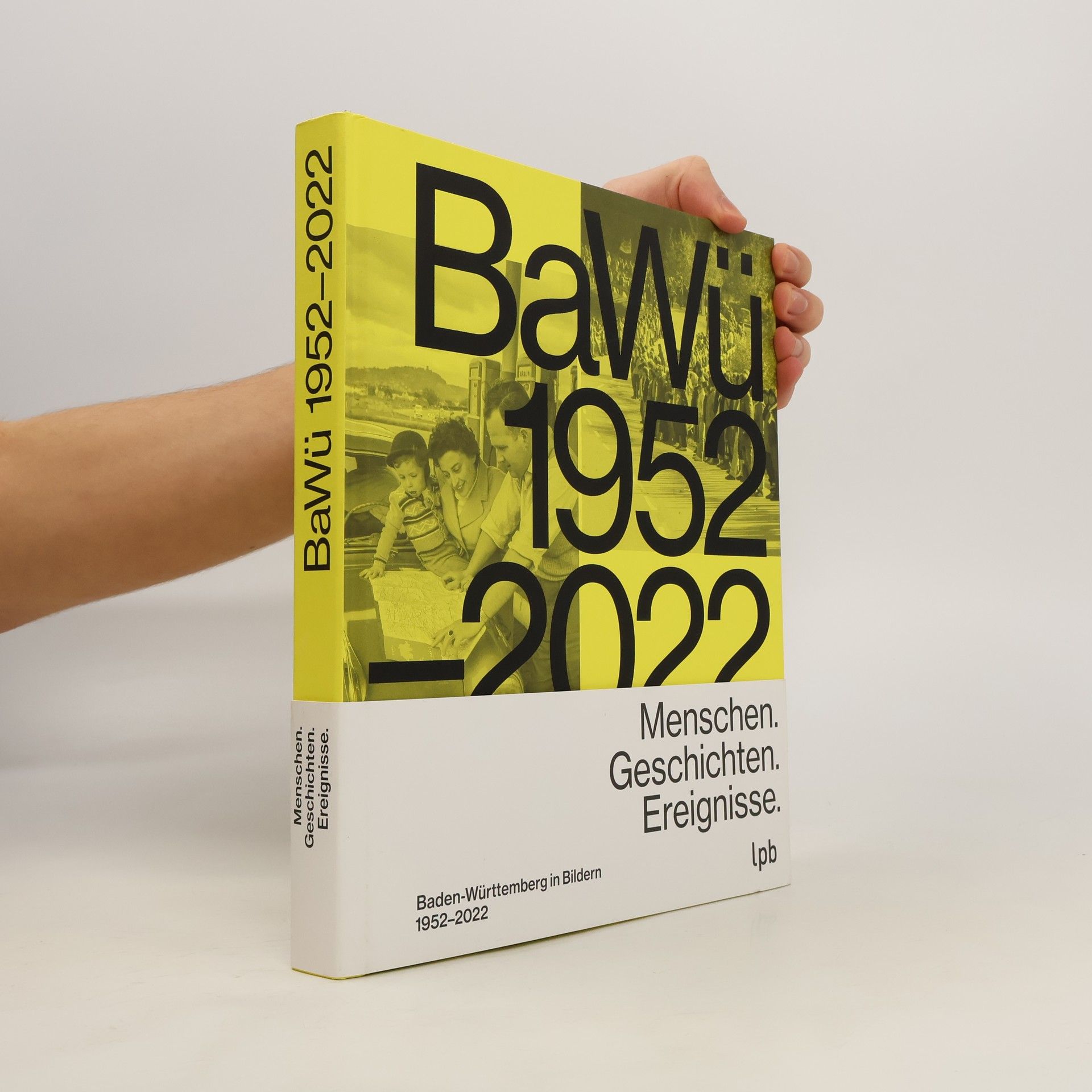
Nicht nur die Grundung der ersten deutschen Demokratie, auch das Frauenstimmrecht feierte 2019 seinen 100. Geburtstag. Dieser Sammelband prasentiert die politischen Auseinandersetzungen, die mit der Einfuhrung des Frauenwahlrechts verbunden waren. Protagonistinnen der badischen und wurttembergischen Frauenstimmrechtsbewegung und das (frauen-)politische Geschehen vor Ort werden vorgestellt. Kulturelle Reprasentationen, statistische Spurensuche und Bilanzen stehen im Mittelpunkt weiterer Beitrage. Sie befassen sich mit dem Niederschlag der Geschichte des Frauenwahlrechts in Museen und Projekten zur Sichtbarmachung der politischen Pionierinnen des deutschen Sudwestens.
Theologie und Alltag
Lehre und Leben in den Predigten der Tübinger Theologen 1550-1750
Diese mit dem Johannes-Brenz-Preis ausgezeichnete Arbeit verbindet rund 1000 Predigten mit theologischen und sozialgeschichtlichen Fragestellungen zu neuen Erklärungsansätzen. Die Autorin untersucht die Transformation theologischer Lehre in sozialethische Normen und analysiert, welche konfessionell gebundenen Norm- und Wertvorstellungen von Theologen bereitgestellt wurden, um in der Volksfrömmigkeit und Volksreligiosität übernommen zu werden. Ein Zugang zur Volkskultur war nur möglich, wenn eine Verbindung zu den Arbeits- und Lebenswelten des einfachen Volkes hergestellt wurde. Die Tübinger Theologen sind besonders geeignet für eine historische Analyse, da sie als Professoren der evangelischen Fakultät und Inhaber württembergischer Kirchenämter agierten, was eine Analyse der Transformation auf höchster Ebene ermöglicht. Die Ergebnisse dieser Langzeitstudie gelten als exemplarisch für die Geschichte des Protestantismus. In den Predigten werden Dimensionen wie Dogmatik, Apologie, Geschichtsdeutung, Lebenswelt, Sozialdisziplinierung und Indoktrination der lutherisch-orthodoxen Predigt deutlich. Die Resultate zeigen die Orthodoxie als eine Kultur, die alle Lebensbereiche umfasst. Die Analyse der Predigten verdeutlicht die dynamischen Beziehungen zwischen Theologie und Alltag: Die Gesellschaft formt Religion, während Religion auch gesellschaftliche Wirklichkeiten konstituiert.
Quellen und Forschungen zur Württembergischen Kirchengeschichte: Der Kirchenkonvent in Württemberg
- 349pages
- 13 heures de lecture