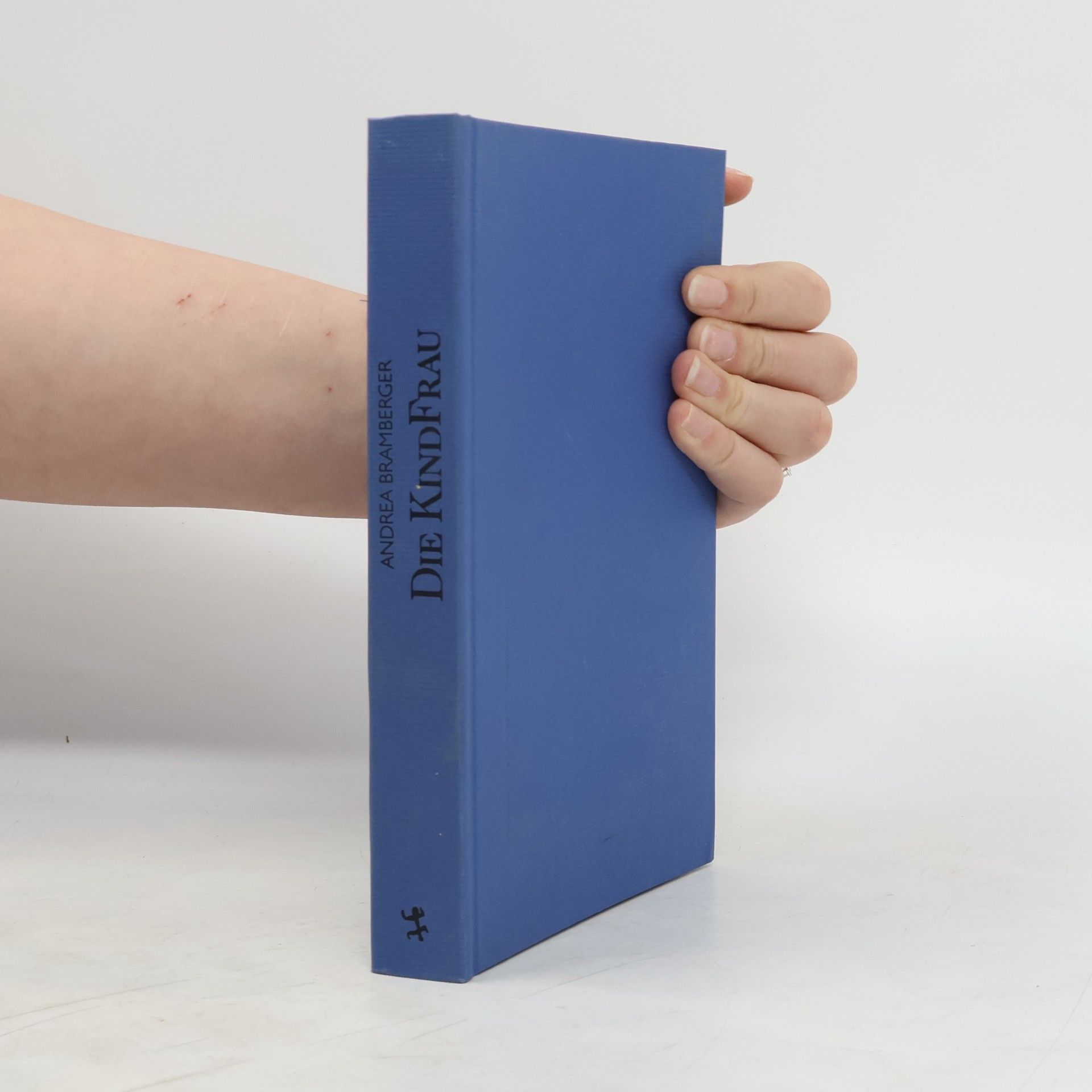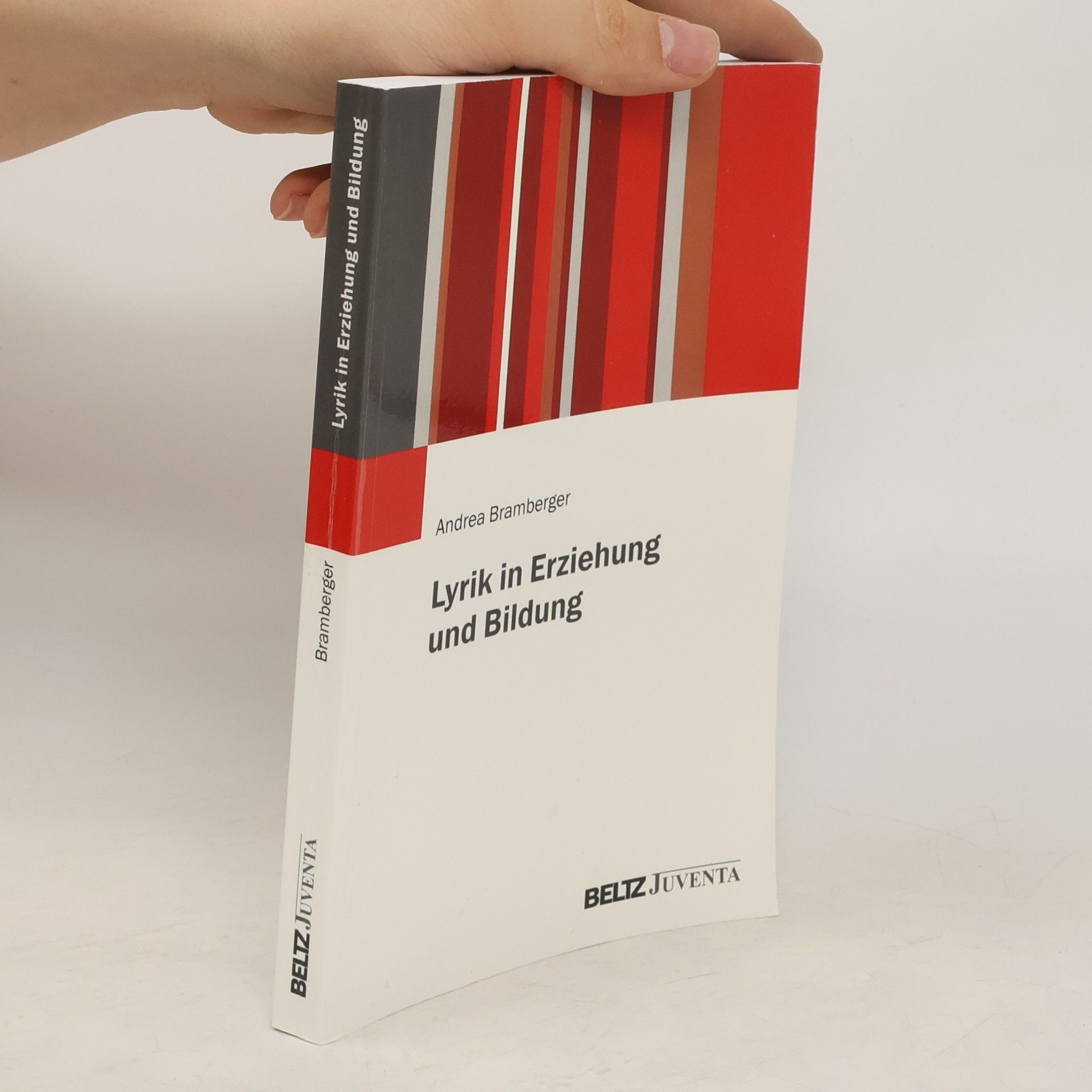Literacy und soziale Gerechtigkeit
Theorie – Empirie – Praktiken
Literacy und soziale Gerechtigkeit stärkt demokratische (Bildungs-)Räume, in welchen ein partizipatorisches Miteinander praktiziert und Vielfalt gelebt wird. Literacy impliziert einen Umgang mit den Bedingungen des Sozialen, das sich mit der Sprache und durch die Sprache zeigt. Lyrik regt performative Didaktiken des Lernens an, in denen Diversität als Bereicherung erlebt wird: Im Schreiben von Gedichten und gemeinsamer Reflexion legen Kinder ihre Einschätzungen über die Sprache offen. Sie erfahren, wie sie durch ihren sprachlichen Ausdruck ihren individuellen Bildungsraum (mit)gestalten können.