Alexander Schmorell ist seit Tagen auf der Flucht, als die Geschwister Scholl hingerichtet werden. Gemeinsam mit Hans Scholl hatte er die „Weiße Rose“ gegründet und deren Flugblätter verfasst. Schmorells Flucht scheitert, und er kehrt nach München zurück, wo sein Fahndungsplakat an den Wänden klebt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er verraten wird. Jutta Schubert schildert in ihrem Roman ein bisher unbekanntes Schicksal des deutschen Widerstands. Die Geschichte basiert auf Interviews mit Zeitzeugen, darunter Familienangehörige und Freunde von Schmorell und anderen Protagonisten der „Weißen Rose“, die mittlerweile verstorben sind. So entsteht ein einzigartiges Dokument seiner misslungenen Flucht und ein Roman, der die Dramatik und Tragik seines Scheiterns nachzeichnet, das in seiner Verhaftung und Hinrichtung mündete. 2004 wurde das Theaterstück „Aus den Archiven des Terrors“ aus dem Interview-Material mit Zeitzeugen vom Jungen Schauspiel Ensemble München uraufgeführt. In der Süddeutschen Zeitung vom 6.2.2010 wurde hervorgehoben, dass die Bühnenfassung des JSEM die Geschichte neu belebt und anders sowie besser erzählt, trotz der Vielzahl an bereits existierenden Filmen und Büchern über die Münchner Widerstandsgruppe im Dritten Reich.
Jutta Schubert Livres




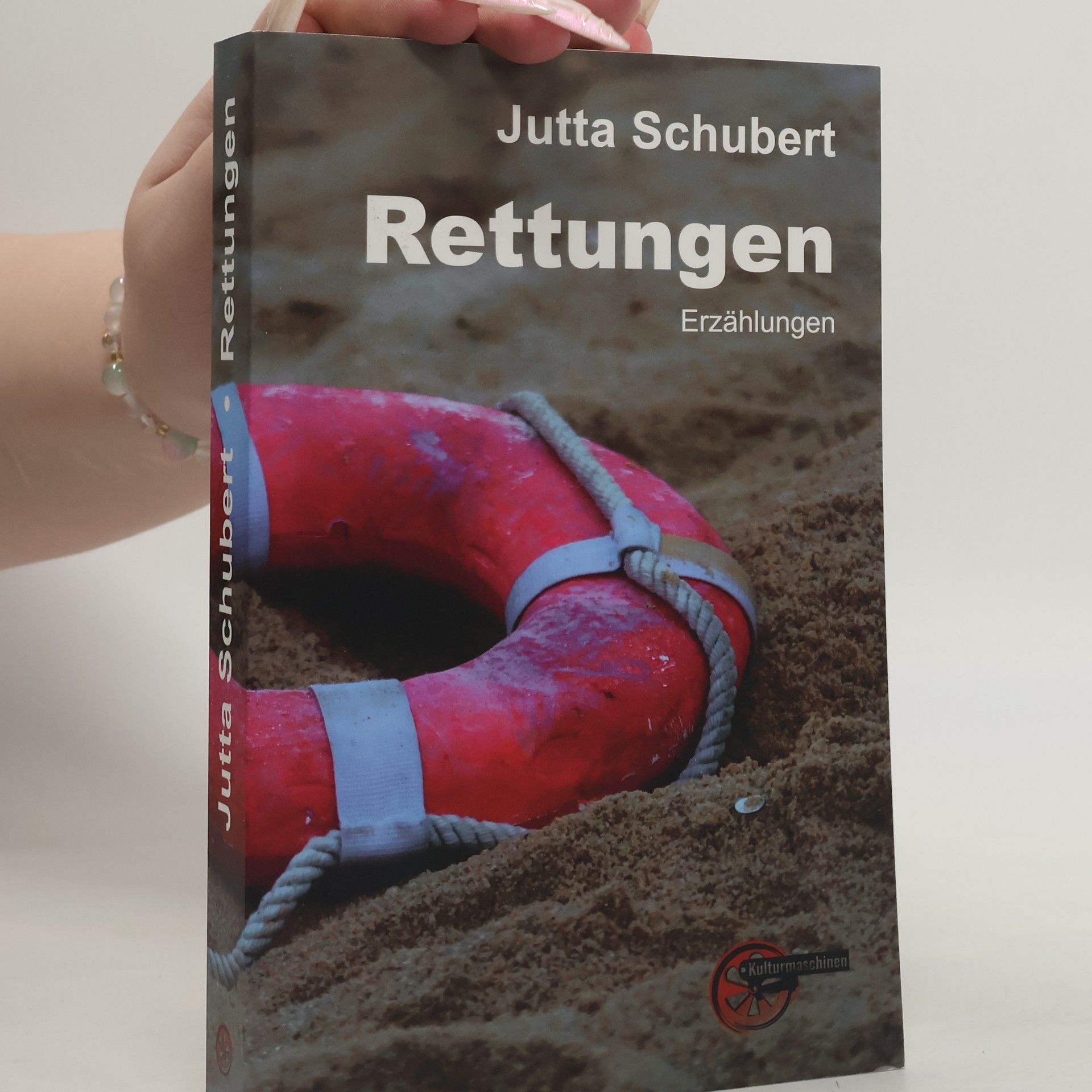
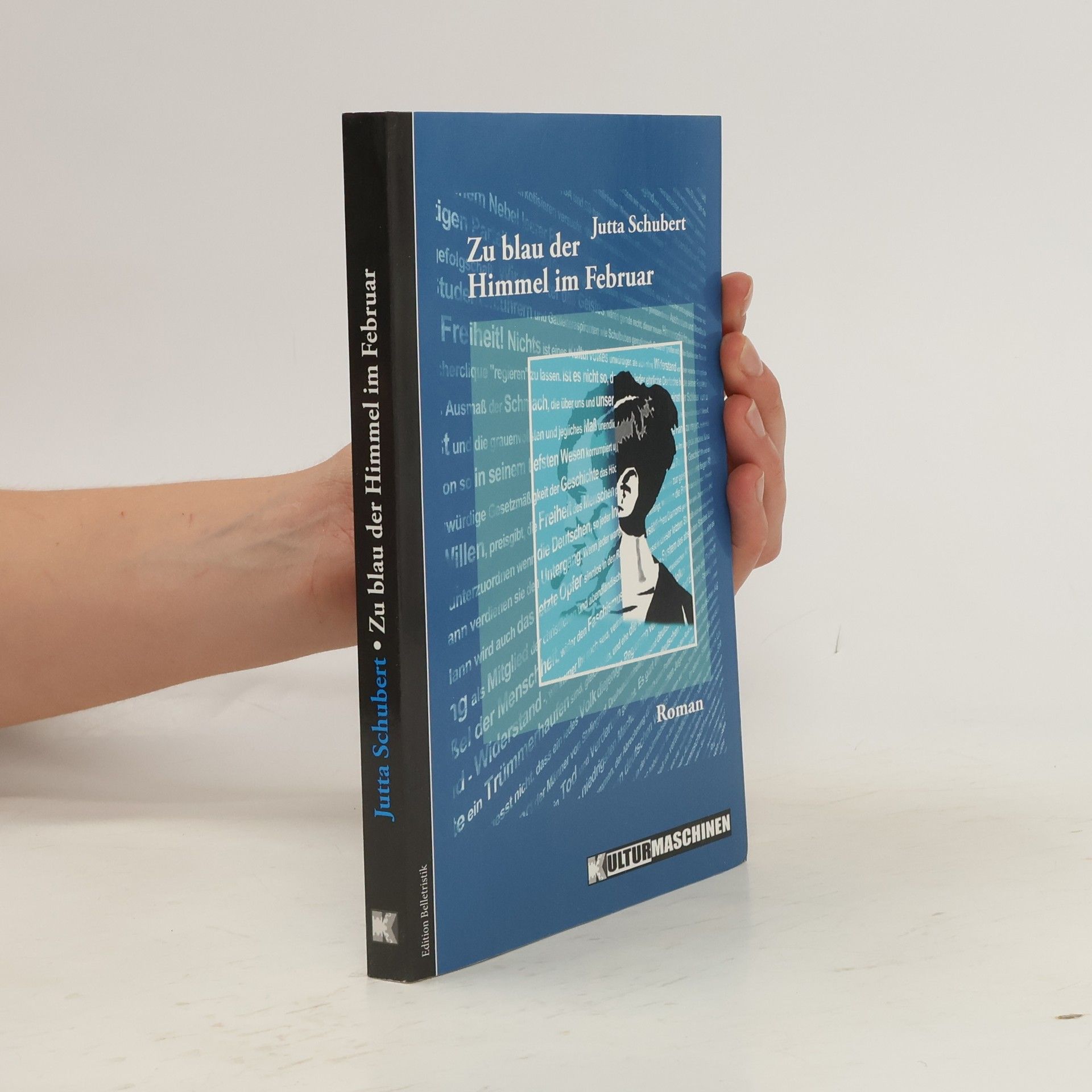
Rettungen
Erzählungen
»Glück kann man nicht bauen, dachte sie, nicht konstruieren, nicht planen, sich schon gar nicht darauf vorbereiten, es weder festhalten noch zu wiederholen versuchen.« Von kleinen Fluchten bis zu Rettungen in letzter Sekunde erzählt dieser Band, und davon, dass Auswege und Neuanfänge möglich sind. Die rasant erzählten Geschichten durchkämmen die Gedankenwelt der Heldinnen und Helden, kreisen um den Kern der Konflikte, zwingen zu Entscheidungen, holen die Figuren aus ihrer Komfortzone.
Den Casanova in einem ärmlichen Zimmer zu finden, indem es wenigstens keine Ratten zu geben scheint und wo er ein Inselt unter der Bettdecke zerdrückt, da stösst Ciacomo zu Sinnieren und zu Schwadronieren an, flaniert durch
Jutta Schuberts Erzählungen sind Abschiedstexte zu Lebzeiten, die thematisch um Vergänglichkeit, Trennung und Flucht kreisen. Es geht darum, etwas zu bewahren, um das Leben weiterhin zu bestehen. Vom Vergehen der scheinbar endlosen Jugend bis zum beschwerlichen Alter. In allen Geschichten spielt der Mond motivisch eine Rolle, mal zentral, mal eher beiläufig. Der Mond ist das Licht in der Nacht, das ein alter Mann sieht, der in seinem Garten steht, den er nicht mehr bearbeiten kann. Es ist das Mondlicht, das die Flüchtlinge in einem französischen Camp benötigen, um nachts auf den Zug nach England zu springen. Oder er wird wie ein Amulett zum Schutzsymbol zweier Reisender.
Zwischen Sein und Spielen
George Tabori - Eine Liebeserklärung
Jutta Schubert verfolgte seine Theaterarbeit bereits als Studentin und begegnete ihm in den frühen Achtzigerjahren als Regieassistentin am Schauspielhaus Bochum unter der Intendanz von Claus Peymann. In ihren Erinnerungen an die Begegnungen mit dem großen Theatermann, dessen Wirken und Person auch ihre eigene Theaterarbeit entscheidend beeinflusst haben, zeichnet sie das Bild eines unvergesslichen Theaterzauberers.