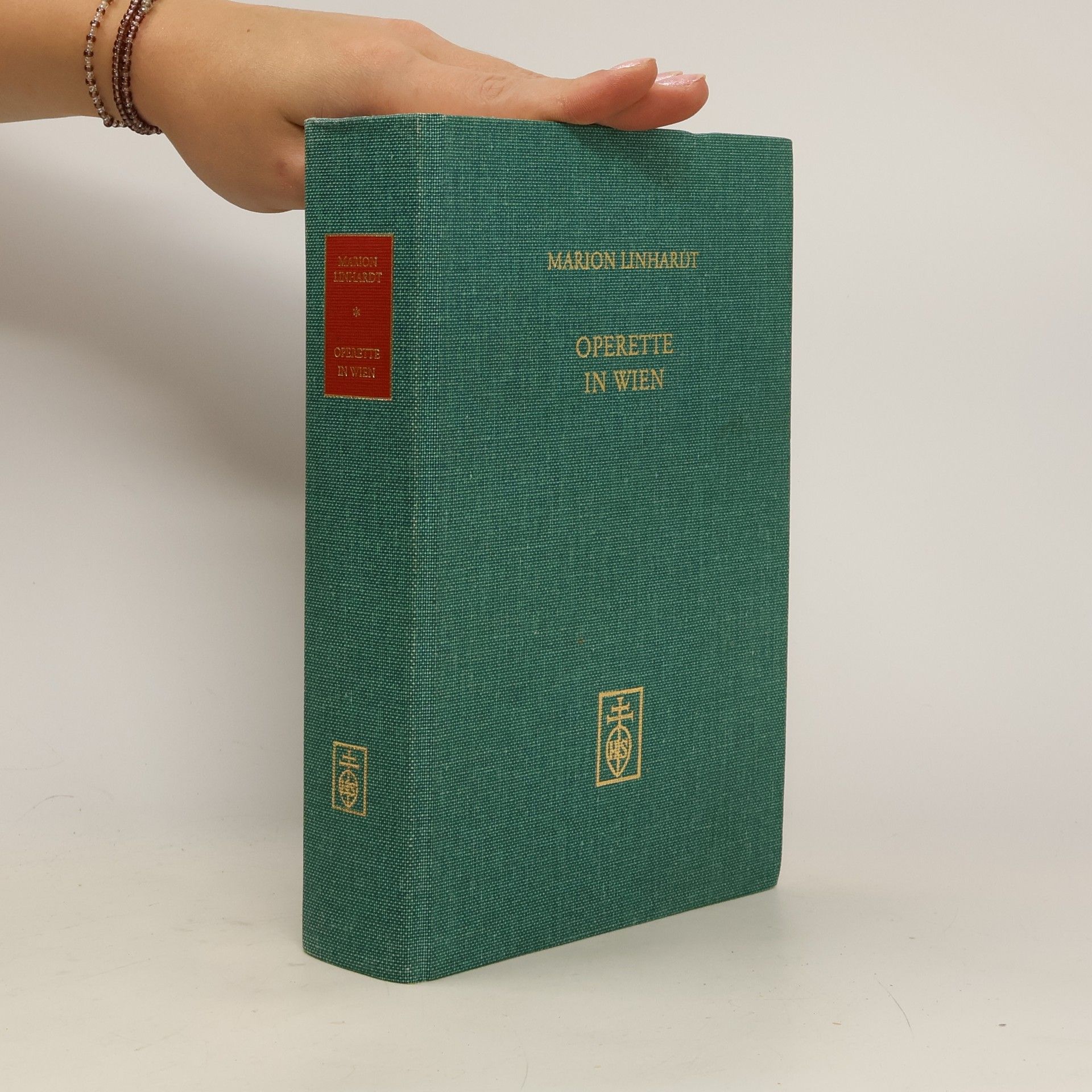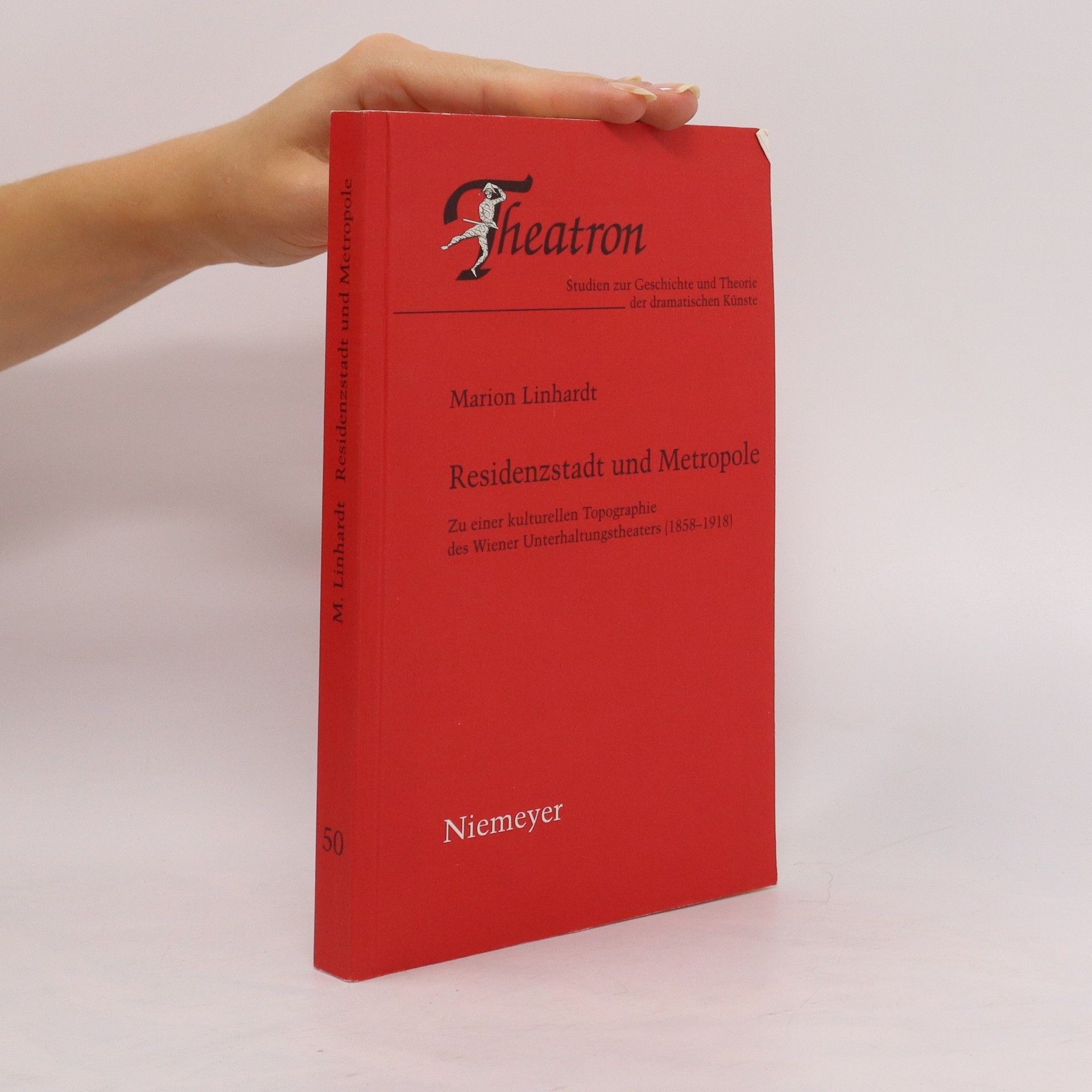Stereotyp und Imagination
Das ‚türkische‘ Bühnenkostüm im europäischen Theater vom Barock bis zum frühen Historismus
- 211pages
- 8 heures de lecture
‚Türkische‘ bzw. ‚orientalische‘ Sujets gehörten im europäischen Theater des 17. und 18. Jahrhunderts zu den besonders häufig aufgegriffenen Themen. Was dieses ‚Türkische‘ für das Theaterpublikum jener Zeit unmittelbar zur Anschauung brachte, waren die auf der Bühne getragenen Kostüme. Mit dem vorliegenden Band wird erstmals eine systematische Annäherung an das ‚türkische‘ Bühnenkostüm unternommen. Anhand umfangreichen Bildmaterials aus mehr als zwei Jahrhunderten werden Kontinuitäten und Entwicklungen der Kostümierungspraxis nachgezeichnet, der die tatsächlich im Osmanischen Reich getragene Kleidung zwar stets als Orientierung diente, die aber doch hauptsächlich von Prozessen der Stereotypisierung und der Imagination bestimmt war.