Hanna Delf von Wolzogen Livres


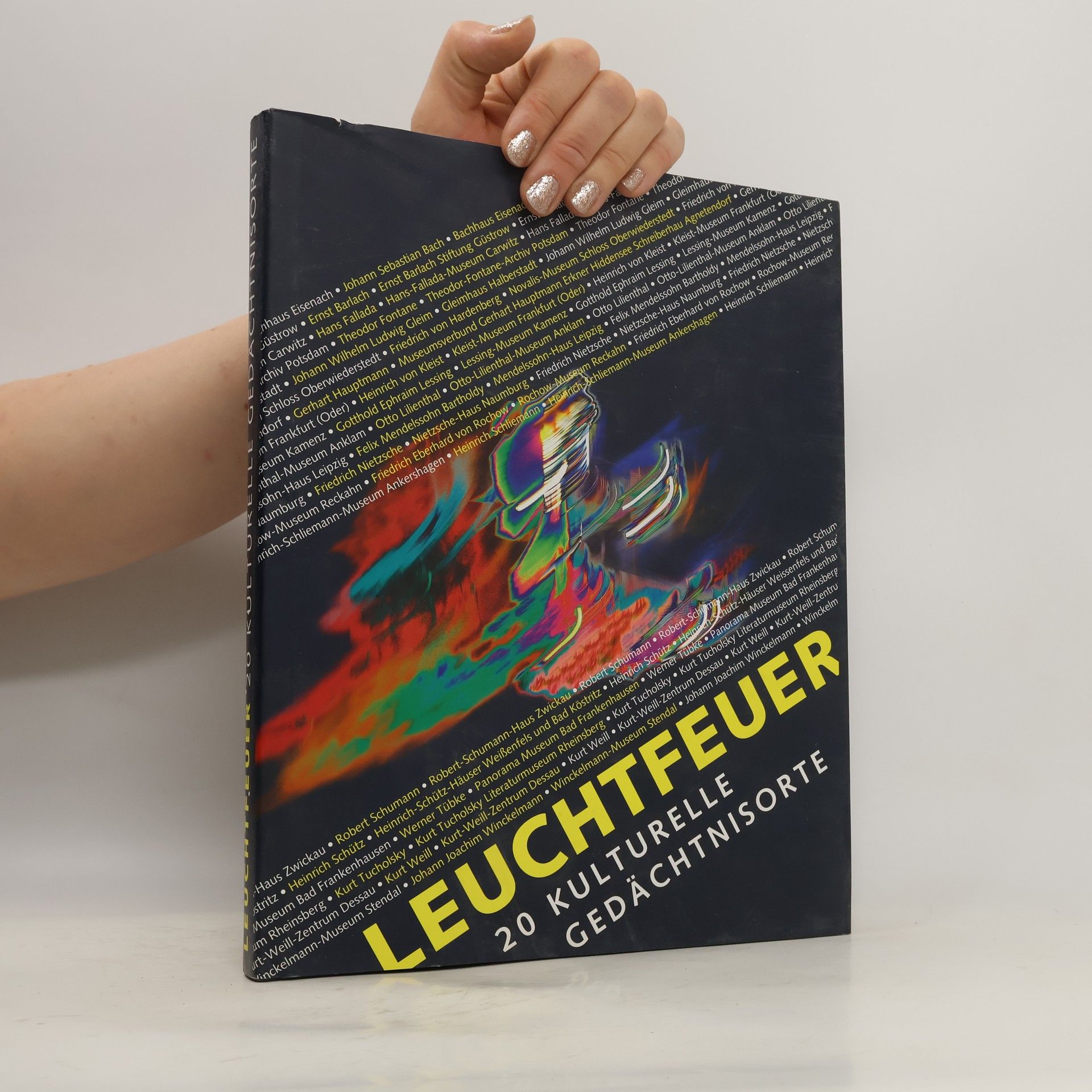
Christa Hackenesch, 1953-2008, studierte Philosophie, Geschichte und Soziologie in Münster, Freiburg und Frankfurt. Sie promovierte 1983 in Tübingen und war seit 1985 wissenschaftliche Mitarbeiterin und Hochschulassistentin an der TU Berlin. Habilitation dort 1998, danach Privatdozentin am Institut für Philosophie der TU Berlin.Veröffentlichungen: Die Logik der Andersheit. Eine Untersuchung zu Hegels Begriff der Reflexion. Frankfurt a. M. 1987; Selbst und Welt. Zur Metaphysik des Selbst bei Heidegger und Cassirer. Hamburg 2001. Mechthild Lemcke, geb. 1951, lebt und arbeitet nach Studien in Philosophie, Geschichte und Literaturwissenschaften als freie Autorin in Frankfurt am Main.Veröffentlichungen: Hegel in Tübingen (Tübingen 1984, mit Christa Hackenesch); Jugendlexikon Philosophie
Die Beiträge des Potsdamer Symposiums erscheinen unter den Themenschwerpunkten REISEN, WERKSTATT und GESCHICHTE UND GESCHICHTEN. Fontanes Wanderungen durch die Mark Brandenburg können als gelungenes Projekt der Literarisierung einer Landschaft gelesen werden. Nach wie vor dienen sie als Reiseführer durch die Mark Brandenburg. Obgleich Fontane selbst die touristische Perspektive durchaus beabsichtigte, fand dieser Aspekt in der Forschung wenig Beachtung. Die Beiträge lesen das Werk im Kontext der europäischen Reiseliteratur neu, fragen nach romantischen Implikationen, Wahrnehmungskonzepten von Landschaft und Geschichte sowie nach Komposition und Textstruktur dieses Work in progress. Beiträger: Wolfgang Albrecht (Weimar), Hugo Aust (Köln), Roland Berbig (Berlin), Renate Böschenstein (Genf), Claudia Buffagni (Sassuolo), Michael Ewert (München), Hubertus Fischer (Hannover), Philipp Frank (Hamburg), Uwe Hentschel (Zepernick), Manfred Horlitz (Potsdam), Gerd Heinrich (Berlin), Erdmut Jost (Berlin), Jerzy KaBázny (Poznan), Ingrid Kuczynski (Duisburg), Michael Masanetz (Leipzig), Rudolf Muhs (London), Stefan Neuhaus (Bamberg), Karl Alfred Opitz (Lisboa), Jan Pacholski (WrocBaw), Gabriele Radecke (München), Eda Sagarra (Dublin), Isabelle Solères (Toulouse), Matthias Schmandt (Bingen), Andreas Stuhlmann (Cork), Peter Wruck (Berlin).