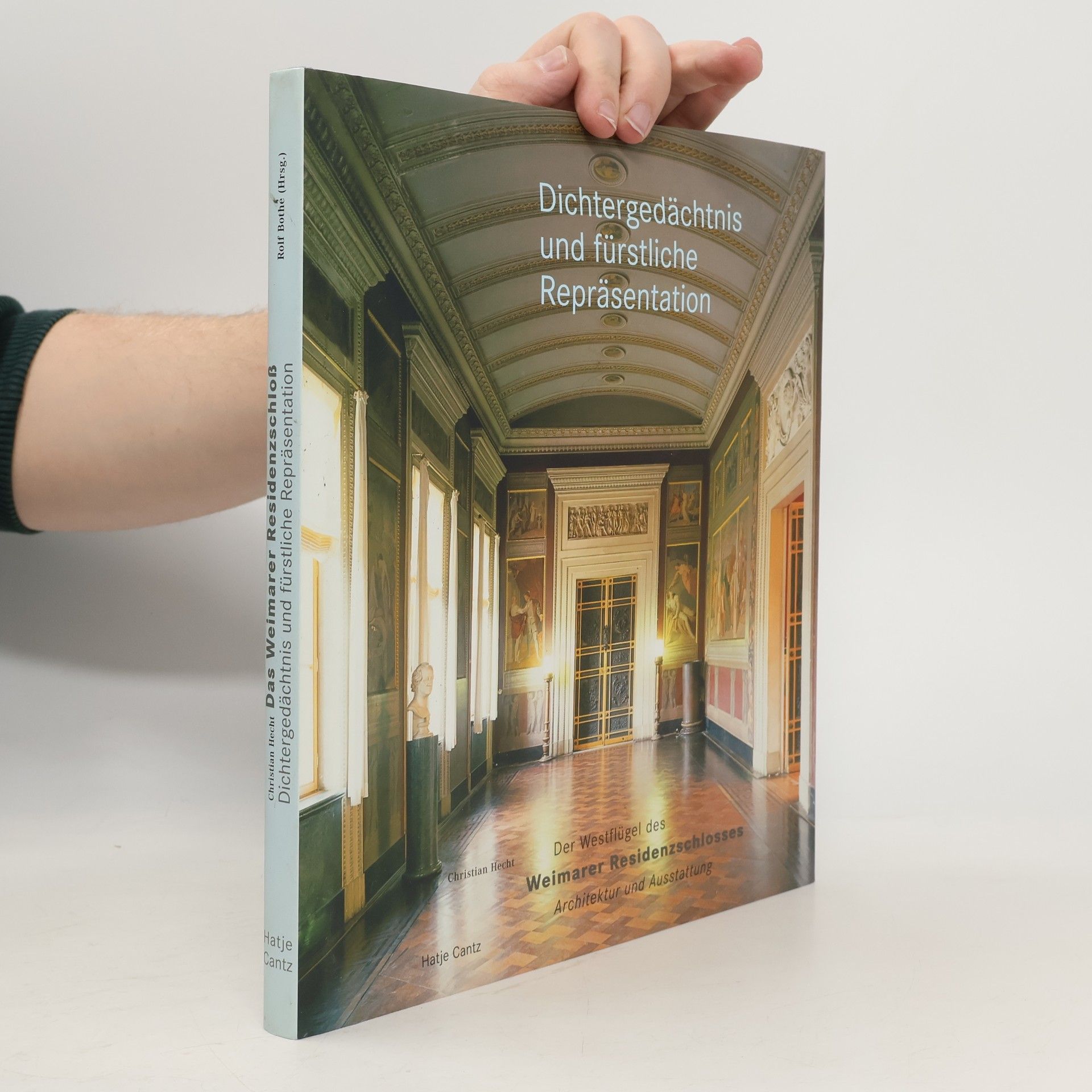Goethes Haus am Weimarer Frauenplan
Fassade und Bildprogramme
Goethe stattete das Wohnhaus, das ihm Herzog Carl August 1792 überlassen hatte, mit ikonografisch bedeutsam aufeinander bezogenen Bildwerken aus, die das barocke Bürgerhaus zum klassizistischen »Dichterhaus« machten. Das Buch erschließt mit grundlegenden Analysen die subtilen Bildprogramme der Goethe`schen Repräsentationsräume und zeigt das Konzept einer am Frauenplan unausgeführten Fassade, deren Hauptmotive jedoch an anderer Stelle eine überraschende Realisierung erfuhren.