Cornelius Borck Livres

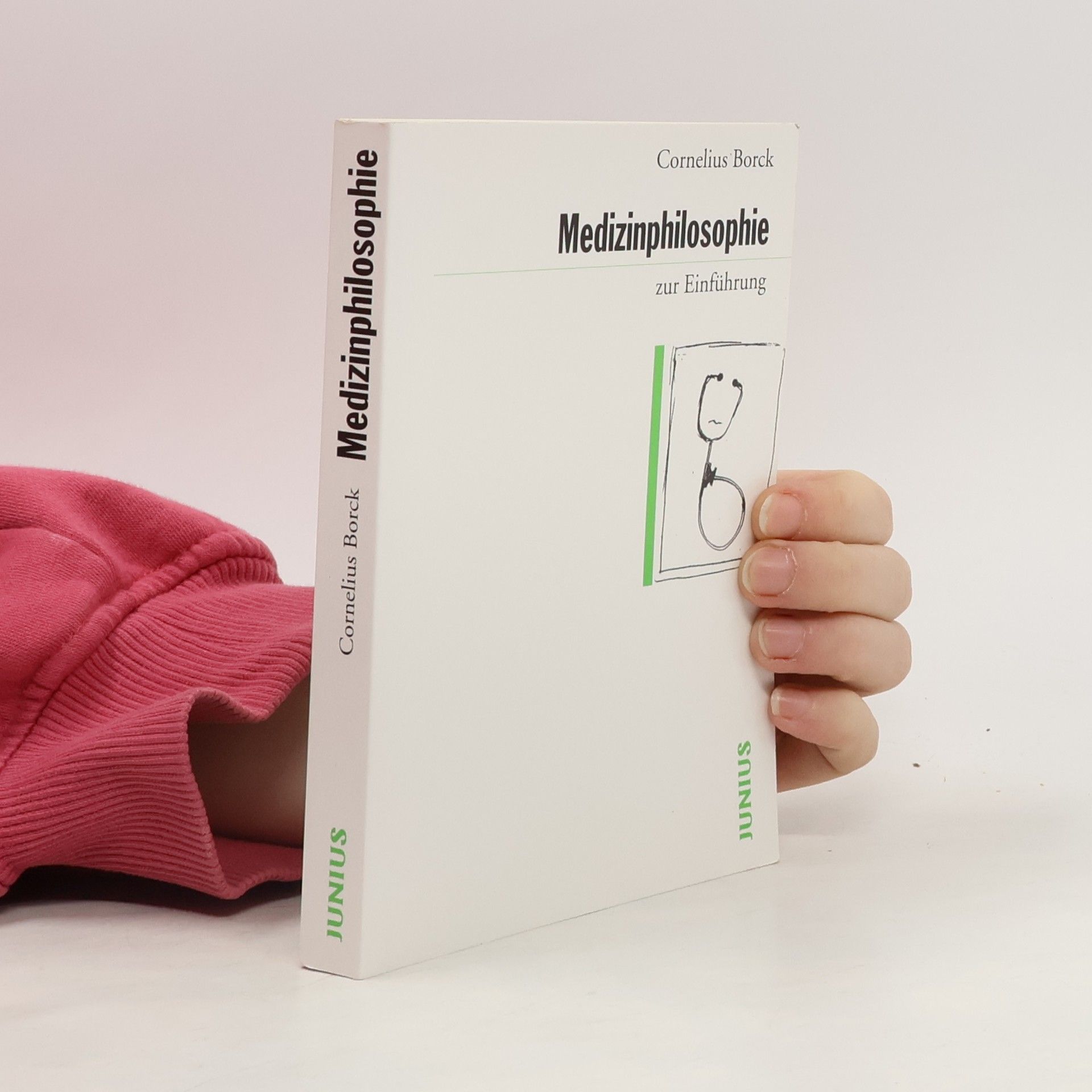


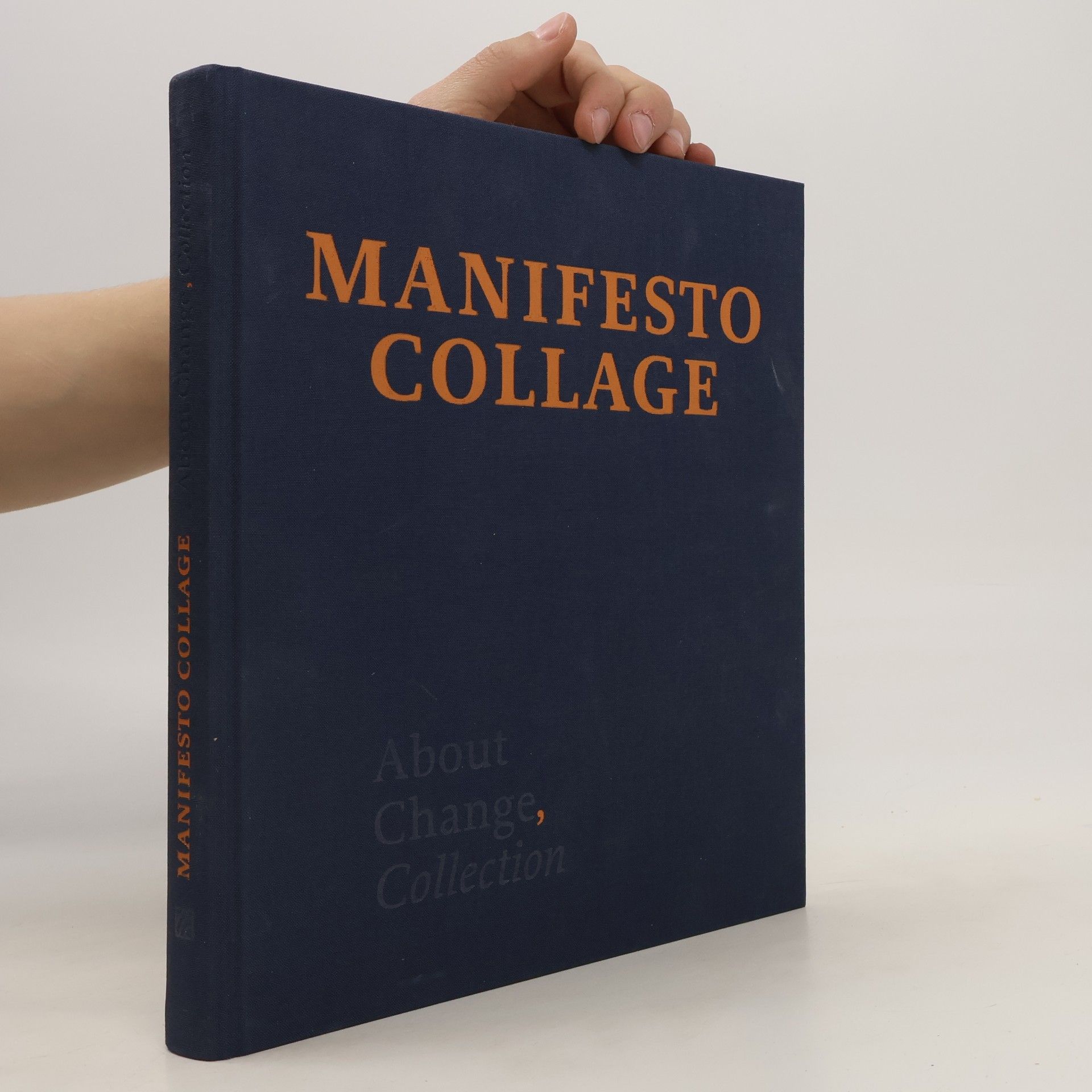
Zwischen Beharrung, Kritik und Reform
Psychiatrische Anstalten und Heime für Menschen mit Behinderung in der deutschen Nachkriegsgeschichte
Psychiatrische Anstalten und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen erregten in jüngerer Zeit öffentliche Aufmerksamkeit, da Betroffene ihre dort gemachten Erfahrungen von Gewalt, Vernachlässigung und Ressourcenmangel publik machten. Die Beiträge dieses Bandes analysieren die Entwicklung der institutionellen Strukturen seit der Nachkriegszeit und ordnen das Handeln der Anstaltsleitungen und die wissenschaftlichen Konzepte, die der Ausübung von Gewalt Vorschub leisteten, zeitgeschichtlich ein. Zudem geben sie Einblicke in die Alltagsgeschichte in den Heimen aus der Sicht der Betroffenen.
Medizin fordert zur Reflexion heraus, weil sie noch nie so umfassend und leistungsfähig war wie heute. Sie interveniert zugleich in die individuelle Erfahrung von Kranksein und in die kulturelle Wahrnehmung von Gesundheit. Zudem ist die Medizin aufgrund ihrer Fortschrittsorientierung einer permanenten Veränderung unterworfen und unterstellt ihre Problemlösungen dem technisch Machbaren und ökonomisch Realisierbaren. Dieses Buch begreift die Medizin als Herausforderung der Philosophie und befragt die Logik ärztlichen Handelns und medizinischen Wissens. Mit den Instrumenten der historischen Epistemologie und medizinischen Phänomenologie arbeitet der Band heraus, wie die Leistungsfähigkeit der Medizin zum Problem geworden Um die Perspektive der Gesundheit wiederzugewinnen, reicht es nicht, dass die Medizin immer besser wird.
Freud and the Neurosciences
- 116pages
- 5 heures de lecture
While still a student, Freud published his first research papers on neurology, showcasing his early scientific career that began with physiological studies on eels and progressed to the nervous system of the river crayfish. Confronted by a physicalistic-scientific worldview from his teachers, Freud embraced it, leading to the development of his earliest psychological theory. Although he later rejected the model that sought to explain the psyche through brain physiology, his scientific curiosity remained focused on uncovering the precise structure of the psyche. The authors argue that the foundations of psychoanalysis are rooted in the same scientific principles that shaped Freud's early neuroscientific research, suggesting that he never fully abandoned this epistemological orientation, even in his later works. The book includes contributions from various scholars, discussing topics such as Freud's dual identity as a neurologist and psychoanalyst, the influence of neurological models on psychoanalysis, and the visual representation of nerve cells and psychical mechanisms. It also examines Freud's legacy in relation to defenses, somatic symptoms, and neurophysiology, as well as concepts like discharge, reflex, free energy, and encoding.