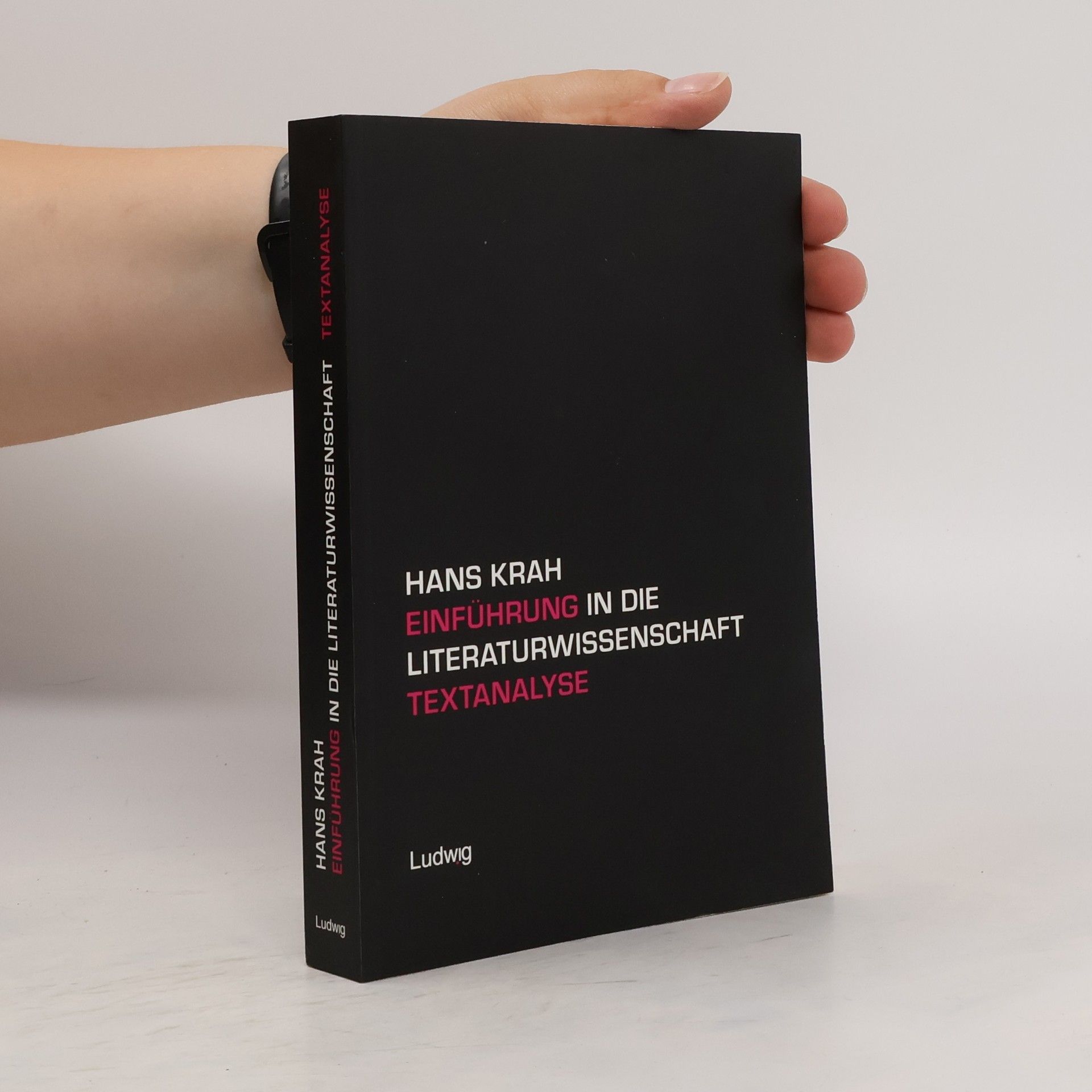Einführung in die Literaturwissenschaft
- 384pages
- 14 heures de lecture
Das Buch führt in die Grundlagen des Verstehens von Texten ein. Ziel ist das Erlernen und Einüben von Herangehensweisen bei der literaturwissenschaftlichen Analyse von Erzählprosa, Dramen und Lyrik an Textbeispielen. Systematisch aufbauend auf grundsätzlichen Fragen nach der Gegenstandsbestimmung (Was ist ein Text? Was ist Literatur?) und der Rekonstruktion von Textbedeutung (Was ist ein Zeichen? Wie konstituiert sich Bedeutung?) werden Analyseinstrumentarien vorgestellt, die zur wissenschaftlichen Interpretation von nicht nur literarischen Texten unabdingbar sind. Der Band ist nicht nur für Studienanfänger geeignet, sondern in seiner Konzeption als Arbeitsbuch studienbegleitend bis zum Examen gedacht. Die neue Auflage 2015 ist komplett überarbeitet und aktualisiert.