Herder und das 19. Jahrhundert /Herder and the Nineteenth Century
Beiträge zur Konferenz der Internationalen Herder-Gesellschaft, Turku 2018
- 458pages
- 17 heures de lecture
Cet auteur explore les profondeurs de la psyché humaine avec une empathie et une perspicacité remarquables. Ses œuvres abordent souvent les complexités des relations interpersonnelles et la recherche d'identité dans le monde moderne. Par une prose méticuleusement travaillée et une imagerie évocatrice, il entraîne les lecteurs dans les mondes intimes de ses personnages. Son écriture se caractérise par une profonde compréhension de la nature humaine et une capacité à saisir les nuances insaisissables des émotions.
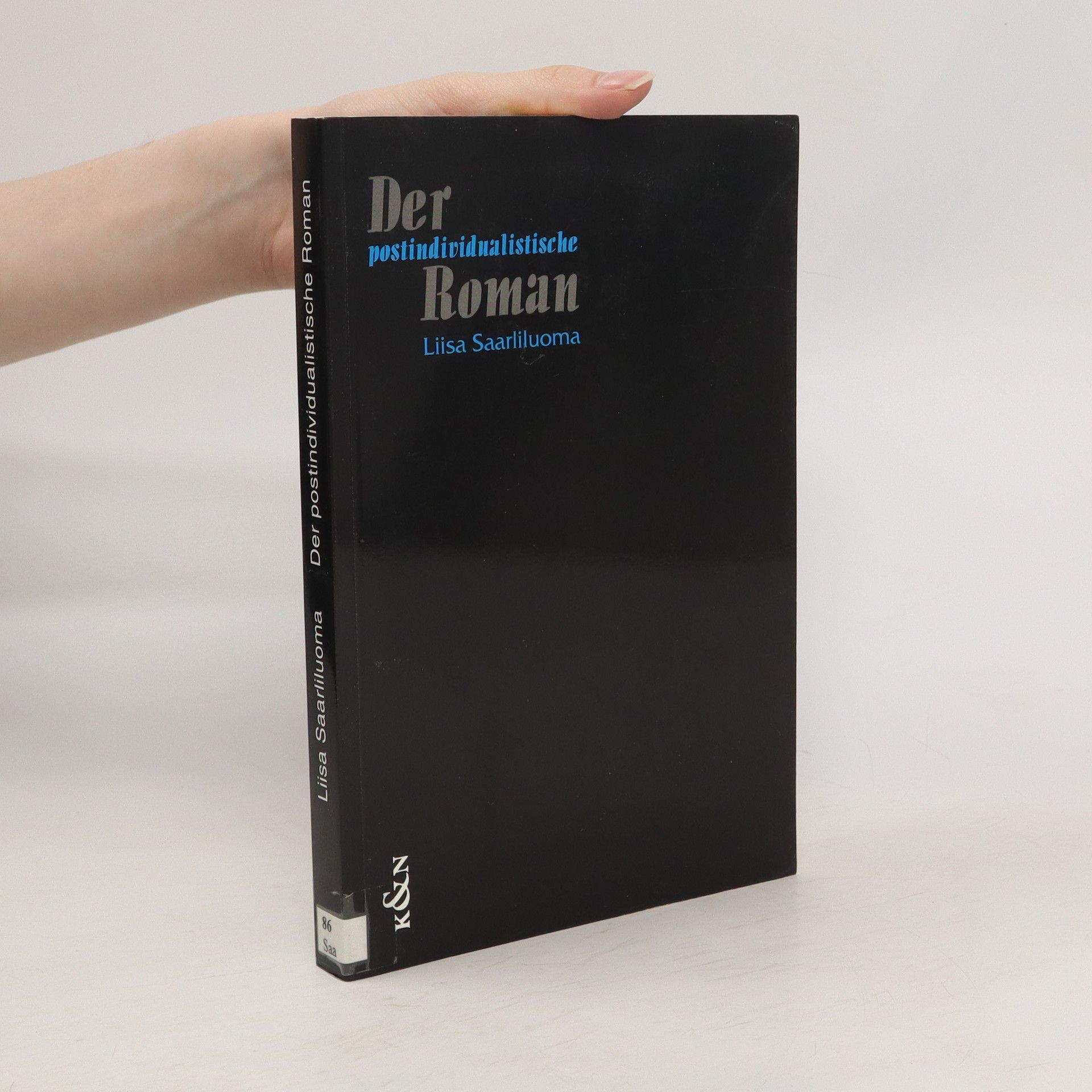


Beiträge zur Konferenz der Internationalen Herder-Gesellschaft, Turku 2018
Myth in the Modern Novel: Imagining the Absolute posits a twofold thesis. First, although Modernity is regarded as an era dominated by science and rational thought, it has in fact not relinquished the hold of myth, a more „primitive“ form of thought which is difficult to reconcile with modern rationality. Second, some of the most important statements as to the reconcilability of myth and Modernity are found in the work of certain prominent novelists. This book offers a close examination of the work of eleven writers from the late eighteenth century to the beginning of the twenty-first, representing German, French, American, Czech and Swedish literature. The analyses of individual novels reveal a variety of intriguing views of myth in Modernity, and offer an insight into the „modernizing“ transformations myth has undergone when applied in the modern novel. The study shows the presence of the „subconscious“, the mythic layer, in modern western culture and how this has been dealt with in novelistic literature.