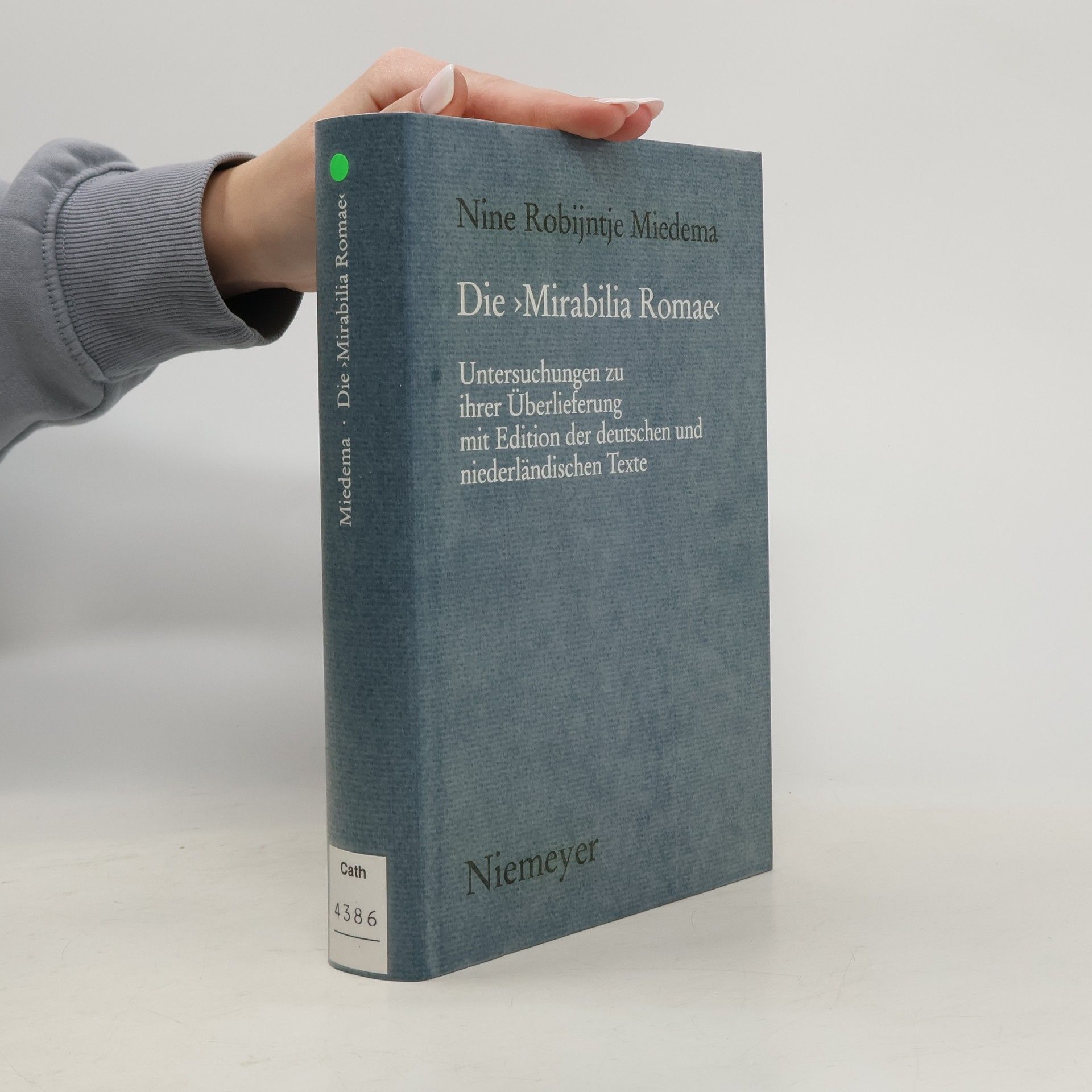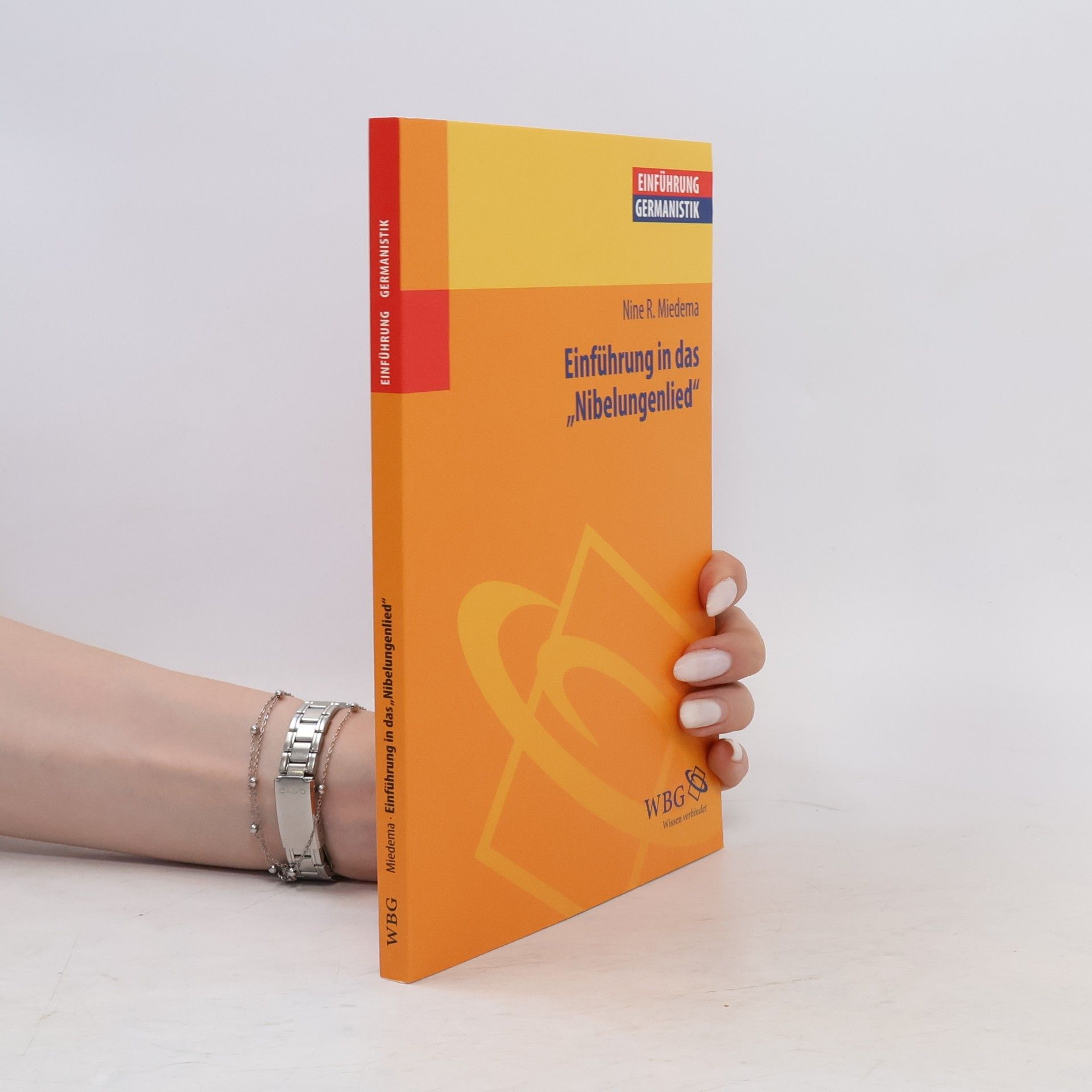Einführung in das "Nibelungenlied"
- 160pages
- 6 heures de lecture
Diese gelungene Einführung ermöglicht endlich ein umfassendes Verständnis des Nibelungenliedes. Sie bietet zum Einstieg eine kompakte Beschreibung der wesentlichen Inhalte und Personen und verortet das Werk in seiner Epoche. Anschließend werden die zentralen Fragen nach Autor, Überlieferung und Werkform beantwortet. Damit ist die Basis für die detaillierte Analyse repräsentativer Stationen des Nibelungenliedes geschaffen. Ausgewählte Âventiuren werden in textnahen Interpretationen präsentiert. Dabei finden aktuelle Forschungsergebnisse und -methoden Berücksichtigung, neben der historischen Dialoganalyse vor allem textkritische, genderbezogene und hermeneutische Ansätze. Die Einführung schließt mit einem Überblick über die Rezeptionsgeschichte und das Nibelungenlied im Schulunterricht.