Thomas Klinkert Livres
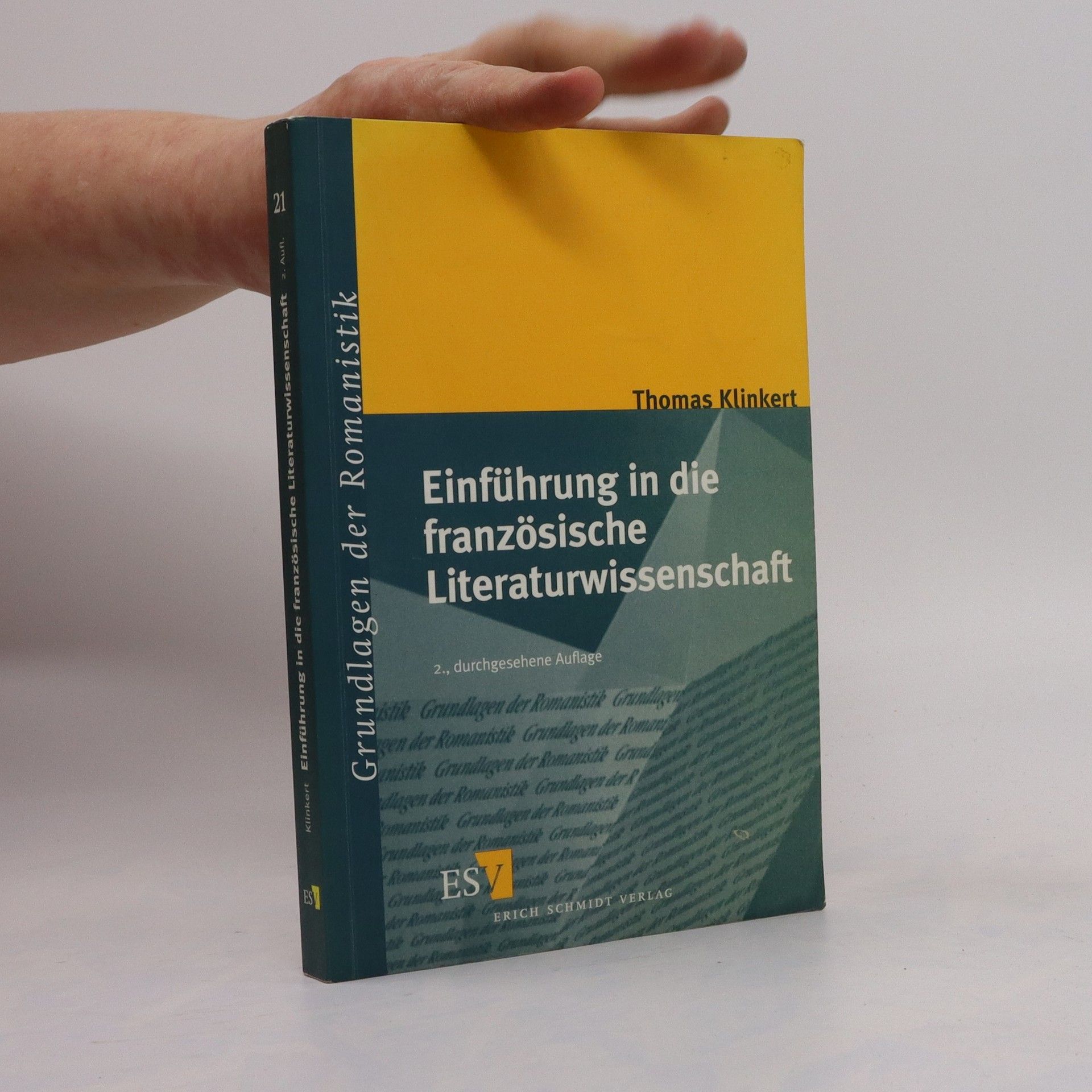



Dante in der romanischen Welt
- 365pages
- 13 heures de lecture
Stadt − Krieg − Literatur
Stadt und Urbanität unter den Bedingungen des Krieges 1914−1945
Was geschieht mit der Stadt und dem urbanen Leben in Kriegszeiten? Dass Städte vom Krieg nie unberührt waren, ist offensichtlich, doch ist es ein Merkmal kriegerischer Gewalt spätestens ab 1914, dass die Grenzen der Front sich auflösen und zwischen der „Heimatfront“, dem eigentlichen Kriegsgeschehen und dem Nachkrieg ein Kontinuum entsteht. Wie gestaltet sich unter diesen Bedingungen die kulturelle Produktion – zwischen privatem Notat und öffentlichem Auftritt, zwischen Zensur und propagandistischer Instrumentalisierung? Welche Art von Literatur entsteht in dieser Situation, und welche Art von Literatur reflektiert sie im Rückblick? Auf welche Weise wird die Stadt zum ideologischen Schlachtfeld – nicht zuletzt auch im Ringen um den Entwurf einer Nachkriegskunst und -gesellschaft? Wie unterscheiden sich Großstädte, die während des Kriegs okkupiert sind, von solchen, die nah, und solchen, die fern dem Kampfgeschehen liegen? Wie wirkt sich die Kriegserfahrung, die an vielen Orten nach Kriegsende in Bürgerkriegszustände übergeht, auf die urbane Kultur der Nachkriegszeit aus? Solchen Fragen gehen die Beiträge dieses Bandes in einer vergleichenden europäischen Perspektive für die Zeit von 1914 bis 1945 nach.
Einführung in die französische Literaturwissenschaft
- 262pages
- 10 heures de lecture
Der Band bietet eine fundierte Einführung in zentrale Bereiche der französischen Literaturwissenschaft, einschließlich der Bedeutung und Funktion von Literatur sowie der Grundbegriffe der Zeichentheorie und sprachlichen Kommunikation. Die Entwicklung der französischen Literatur wird anhand ausgewählter Beispiele im Kontext der Mediengeschichte erläutert. Die Theorie literarischer Gattungen wird durch detaillierte Analysen narrativer, dramatischer und lyrischer Texte erschlossen, wobei die einzelnen Schritte nachvollziehbar dargestellt sind. Der ESVbasics-Band richtet sich an Studierende, die sich einen umfassenden Überblick über zentrale Themen ihres Fachs verschaffen möchten. Dank der didaktischen Präsentation wird eine schnelle und eigenständige Anwendung des Gelernten ermöglicht, was das Buch ideal für Selbststudium, studienbegleitende Lektüre oder Examensvorbereitung macht. Jedes Kapitel enthält ausführliche Literaturhinweise, und ein umfangreiches Sach- und Namenregister rundet den Band ab. Die Lektüre ist auch für nicht auf die Literaturwissenschaft spezialisierte Romanisten lohnenswert. Die Einführung wird als ein prägnanter Beitrag zur Diskussion grundlegender Probleme der Literaturwissenschaft gewürdigt.