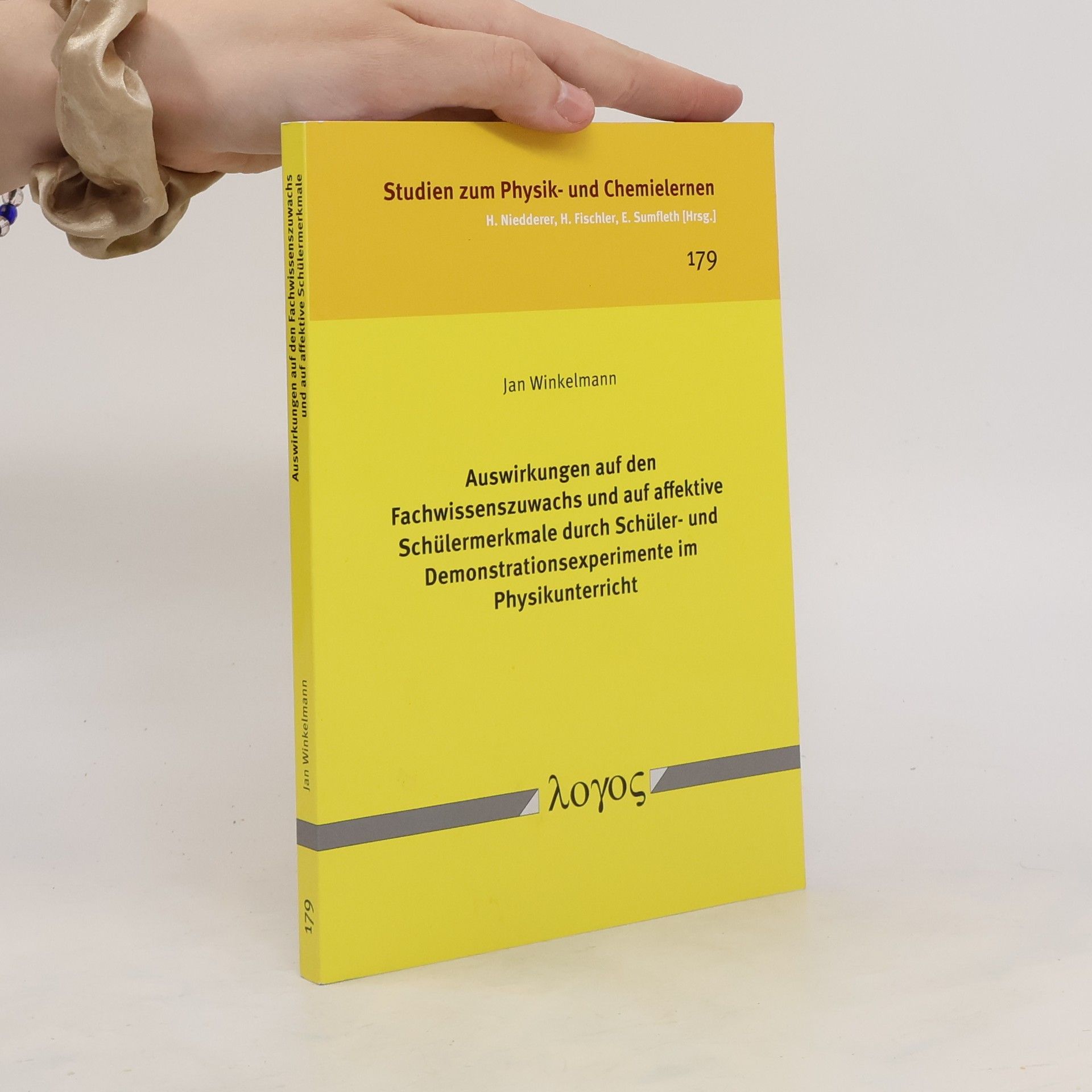Der aktuelle Forschungsstand zum Einfluss von Experimenten auf den Lernzuwachs von Schülerinnen und Schülern im naturwissenschaftlichen Unterricht zeigt ein heterogenes Bild: Einige Studien betonen Vorzüge des selbstständigen Experimentierens durch die Schülerinnen und Schüler, andere erkennen Vorteile durch Demonstrationsexperimente. Gleichzeitig ist es schwierig, die zur Verfügung stehenden Ergebnisse miteinander zu vergleichen, da zum Teil sehr unterschiedliche Studiendesigns und nicht immer eine ausreichende Kontrolle von Variablen berichtet werden. Im Rahmen der vorliegenden Vergleichsstudie (n = 858) wurde der Einfluss unterschiedlicher Experimentiersituationen auf u. a. den Fachwissenszuwachs von Schülerinnen und Schülern untersucht. Die Forschungsfrage lautete, ob durch Schülerexperimente oder durch Demonstrationsexperimente ein besseres Verständnis der geometrischen Optik erzielt werden kann. Es konnte gezeigt werden, dass nicht die Experimentiersituation selbst, sondern die Wechselwirkung von unterrichtender Lehrkraft und der jeweiligen Experimentiersituation maßgeblich ist. Für das Lernen der Schülerinnen und Schüler ist es entscheidend, bei welcher Lehrkraft sie welche Experimentiersituation erleben.
Jan Winkelmann Livres