Reinhard Johler Livres
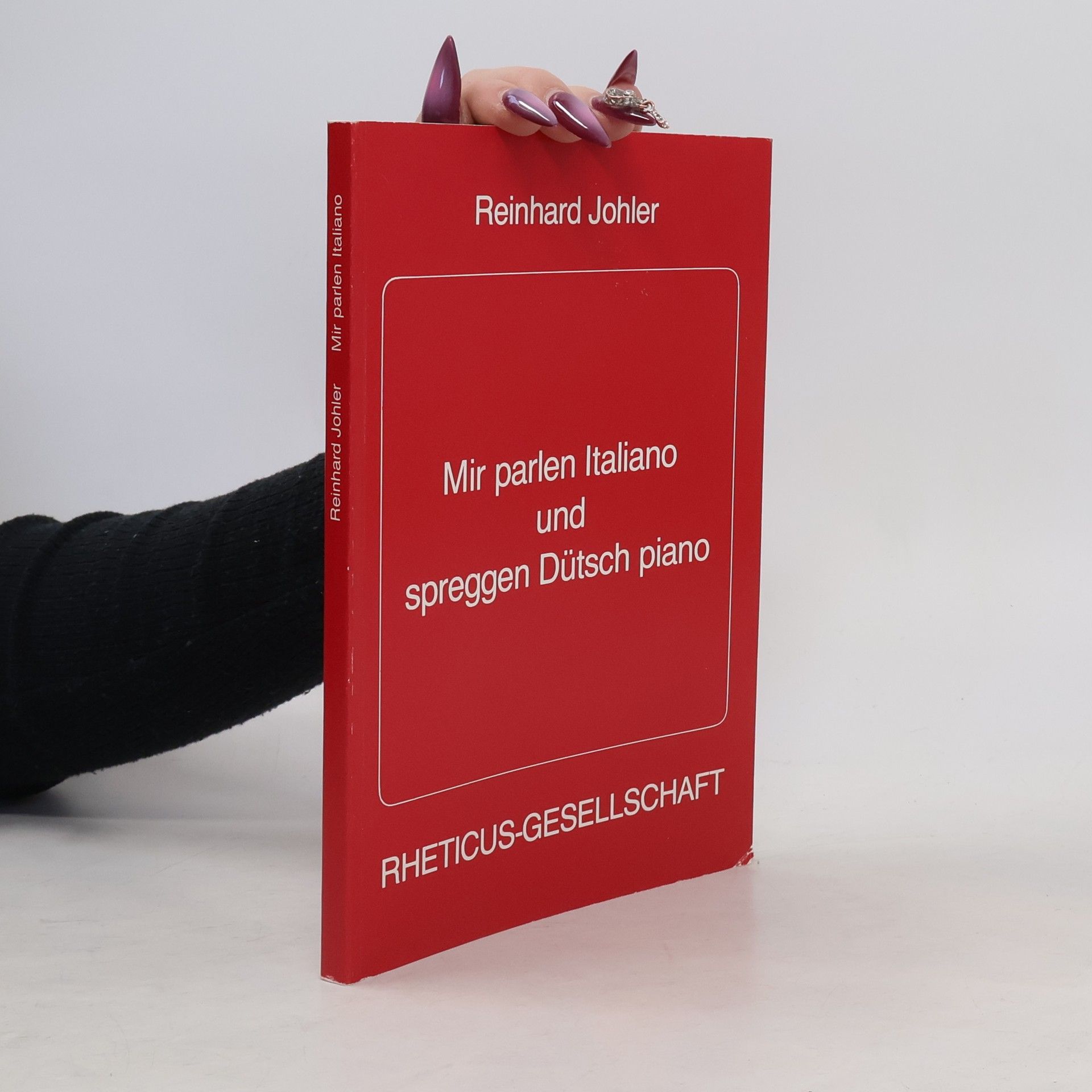
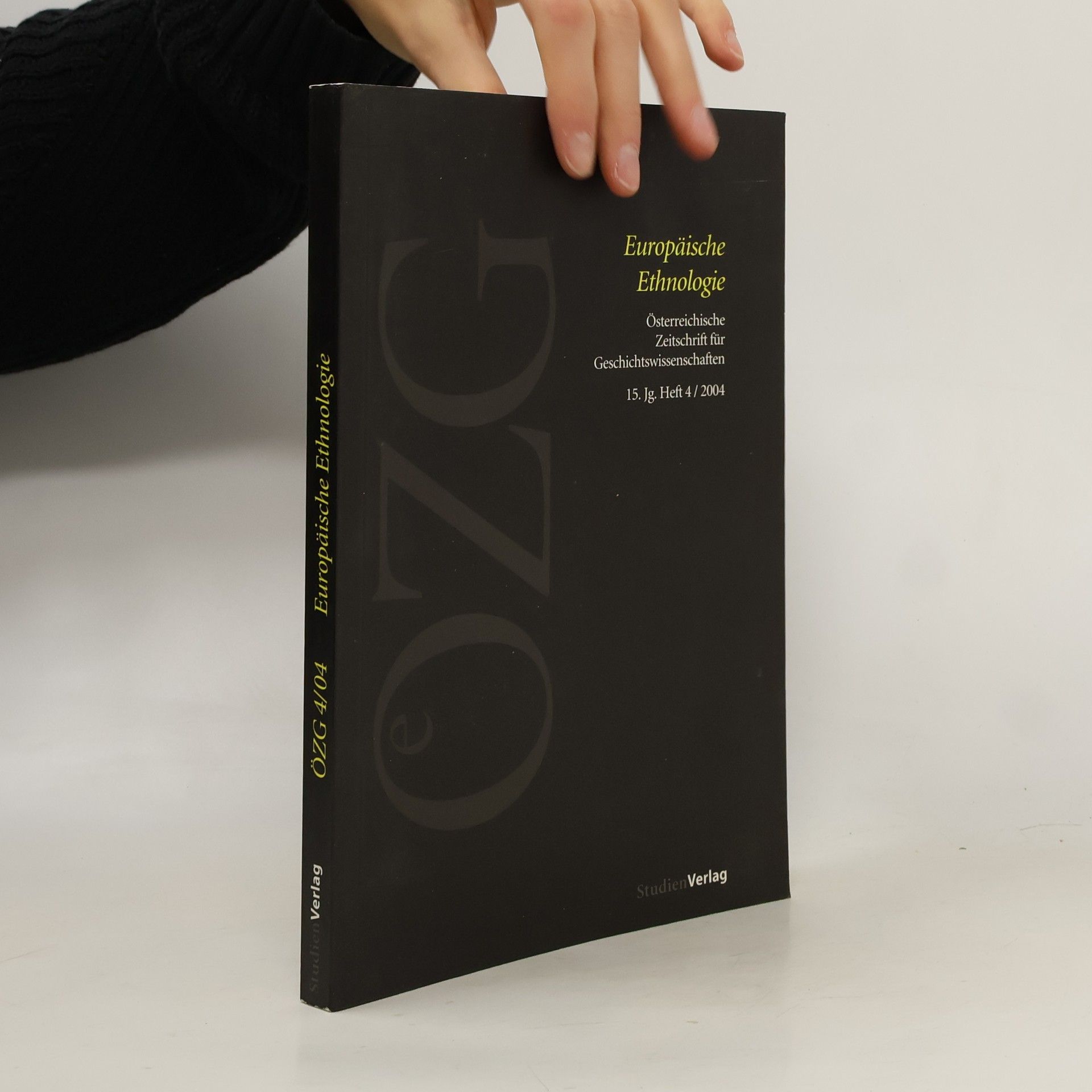
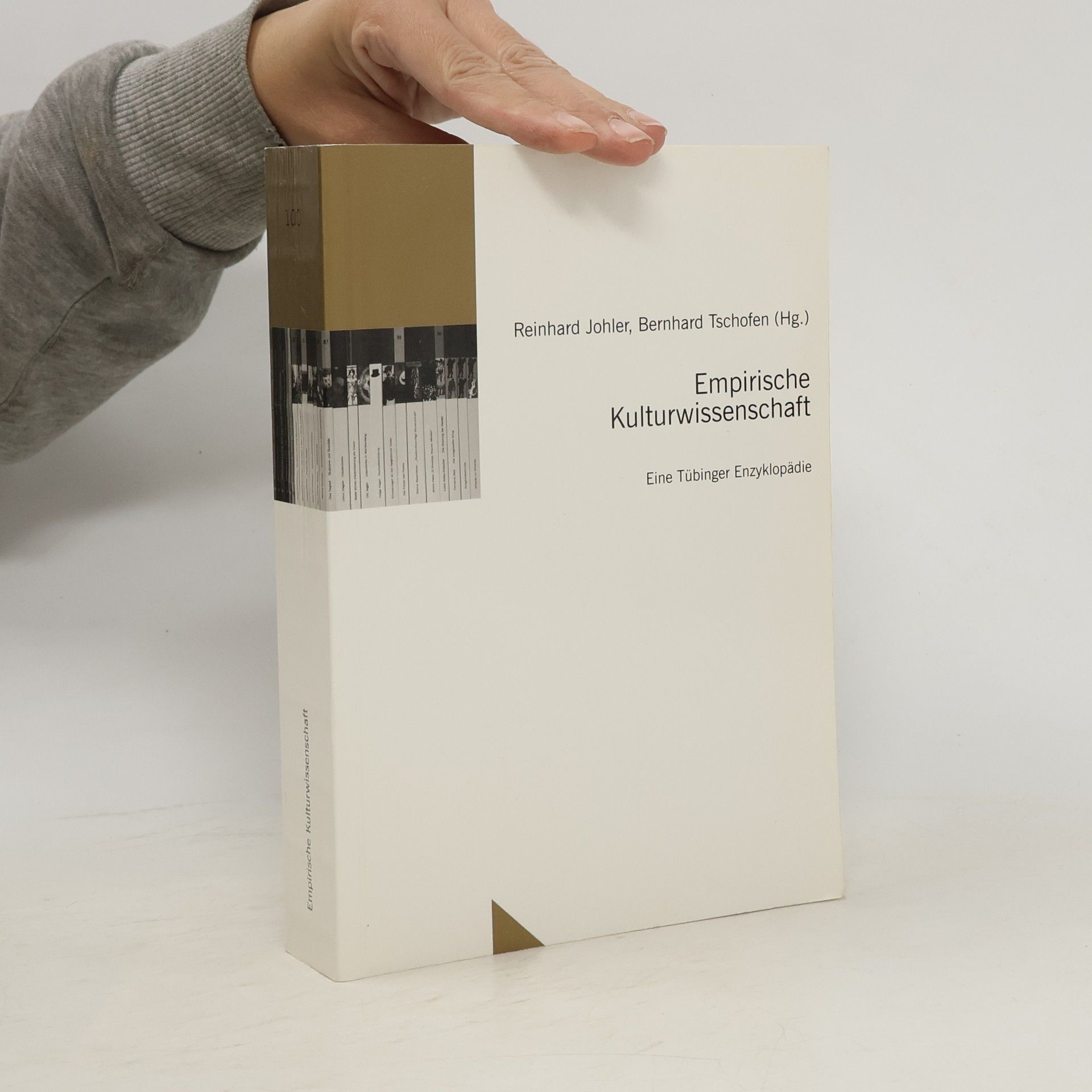
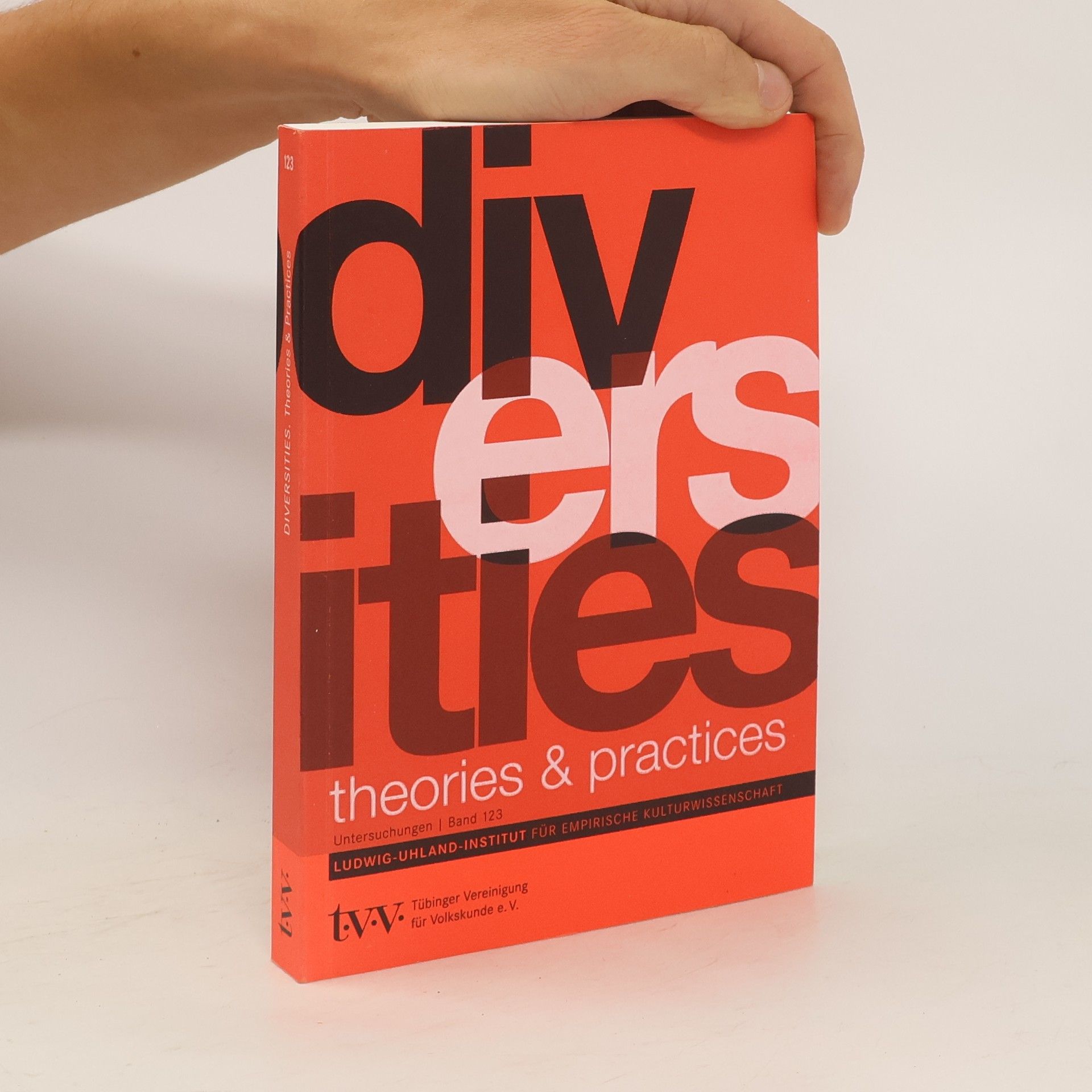
Seit 45 Jahren setzen die „Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Instituts“ Maßstäbe. Die zunächst mit „Volksleben“ überschriebene Reihe hat nicht nur die Fortentwicklung der Volkskunde zur Empirischen Kulturwissenschaft eingeleitet und bald den „Abschied vom Volksleben“ im eigenen Titel vollzogen, sondern sie begleitet seither in Monographien und Sammelbänden die Diskussionen um Standort und Zugangsweisen des „Vielnamenfaches“ weit über Tübingen hinaus. Bände der Reihe haben der Kulturwissenschaft neue Felder erschlossen, haben Konzepte der historischen und ethnographischen Forschung erprobt und vor allem empirisch vertieft. Sie dokumentieren bis heute Kontinuität wie Dynamik der Arbeit im Ludwig-Uhland-Institut und das hier praktizierte Verständnis einer Analyse popularer Kulturen.