Am 24. Juni 1922 wurde Walther Rathenau, Reichsaußenminister der Weimarer Republik, auf offener Straße erschossen. Kein anderes Ereignis hat die Republik von Weimar stärker erschüttert als die Serie von Anschlägen von 1921/1922, die gegen Rathenau und den früheren Reichsfinanzminister Matthias Erzberger, gegen den ersten deutschen Ministerpräsidenten Philipp Scheidemann und schließlich auch gegen den Publizisten Maximilian Harden verübt wurden.Martin Sabrow geht der Frage nach: Waren die Attentate aufgehetzten Einzeltätern zuzuschreiben, oder steckte hinter ihnen das organisierte Mordkomplott eines Geheimbundes? Der schon von den Zeitgenossen verdächtigten Organisation »Consul« konnte (oder wollte) die deutsche Jusitz keine Schuld nachweisen. Und doch hatte sie offensichtlich alle Fäden in der Hand gehabt. Der Autor deckt die Geschehnisse von damals auf. Er weist die bewusste Rechtsbeugung der konservativ denkenden Justiz nach und erklärt, warum das Ziel der Attentatsserie in der Öffentlichkeit nie vollständig bekannt werden konnte: Sie sollte der geheimgehaltene Auftakt zur deutschen Gegenrevolution werden.
Martin Sabrow Livres
Martin Sabrow est un historien et politologue reconnu pour ses contributions à l'étude de l'histoire contemporaine. Son travail explore la relation complexe entre la mémoire historique, la transformation politique et l'évolution sociétale. En tant qu'universitaire de premier plan, il offre des perspectives profondes sur les dynamiques qui façonnent notre compréhension du passé et du présent.
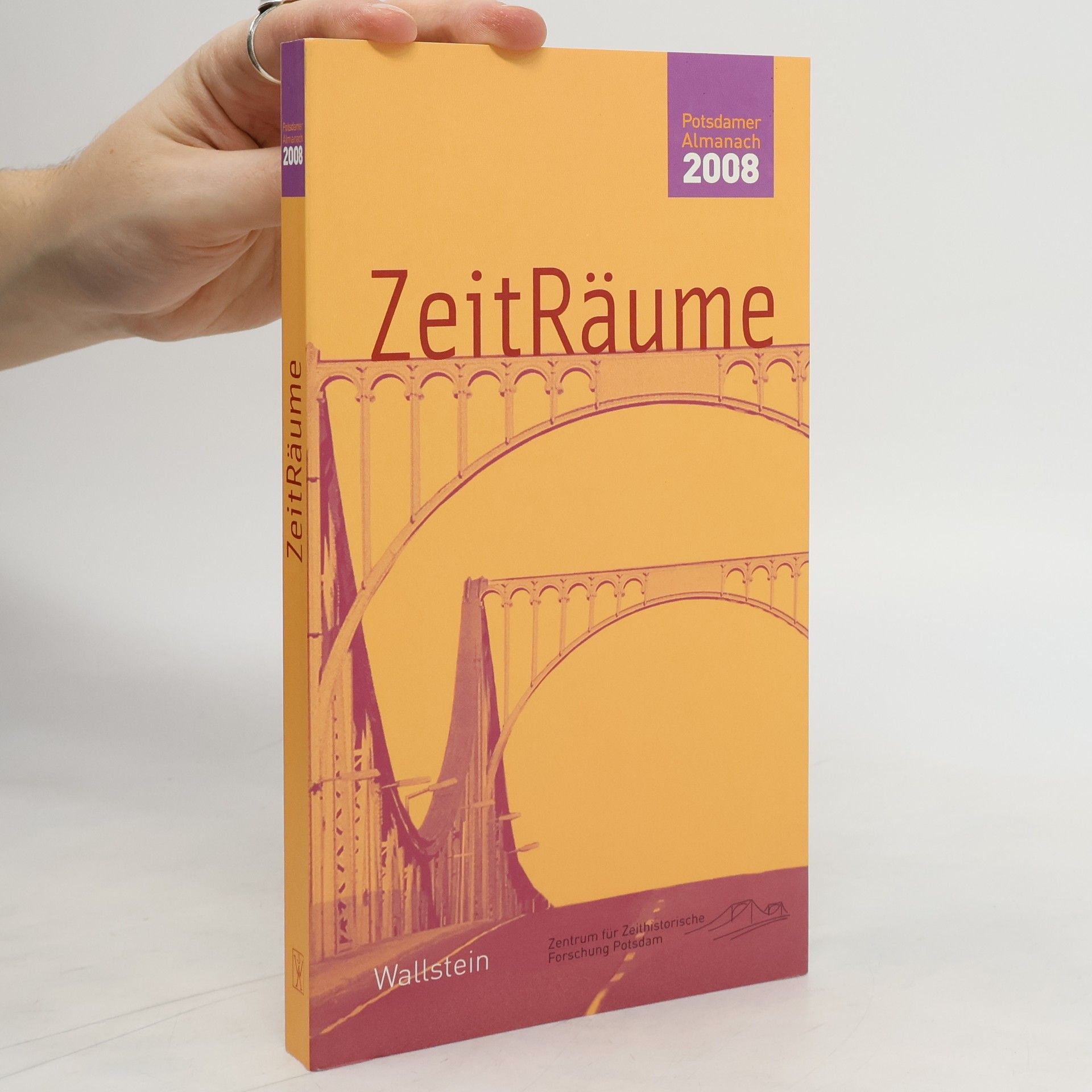

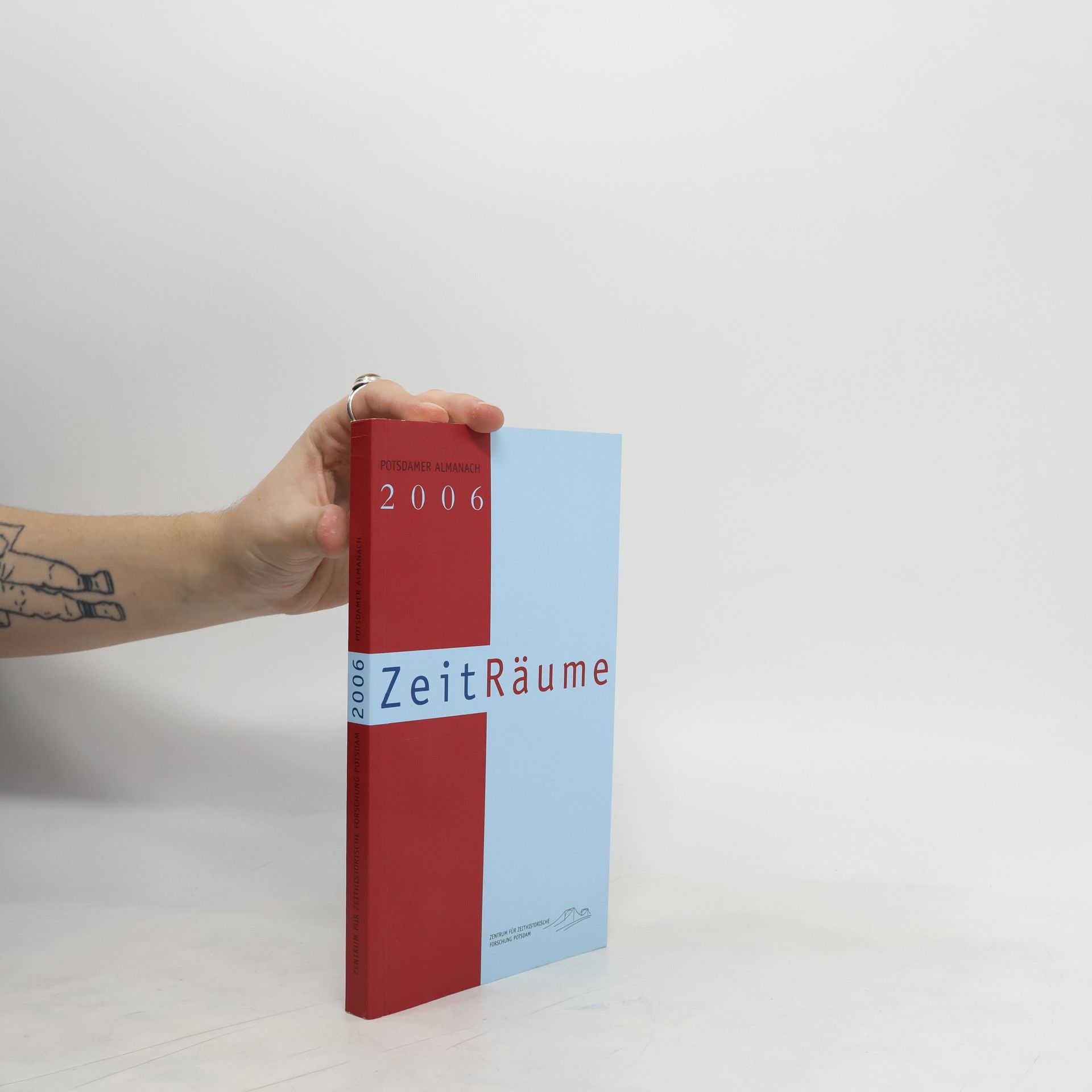
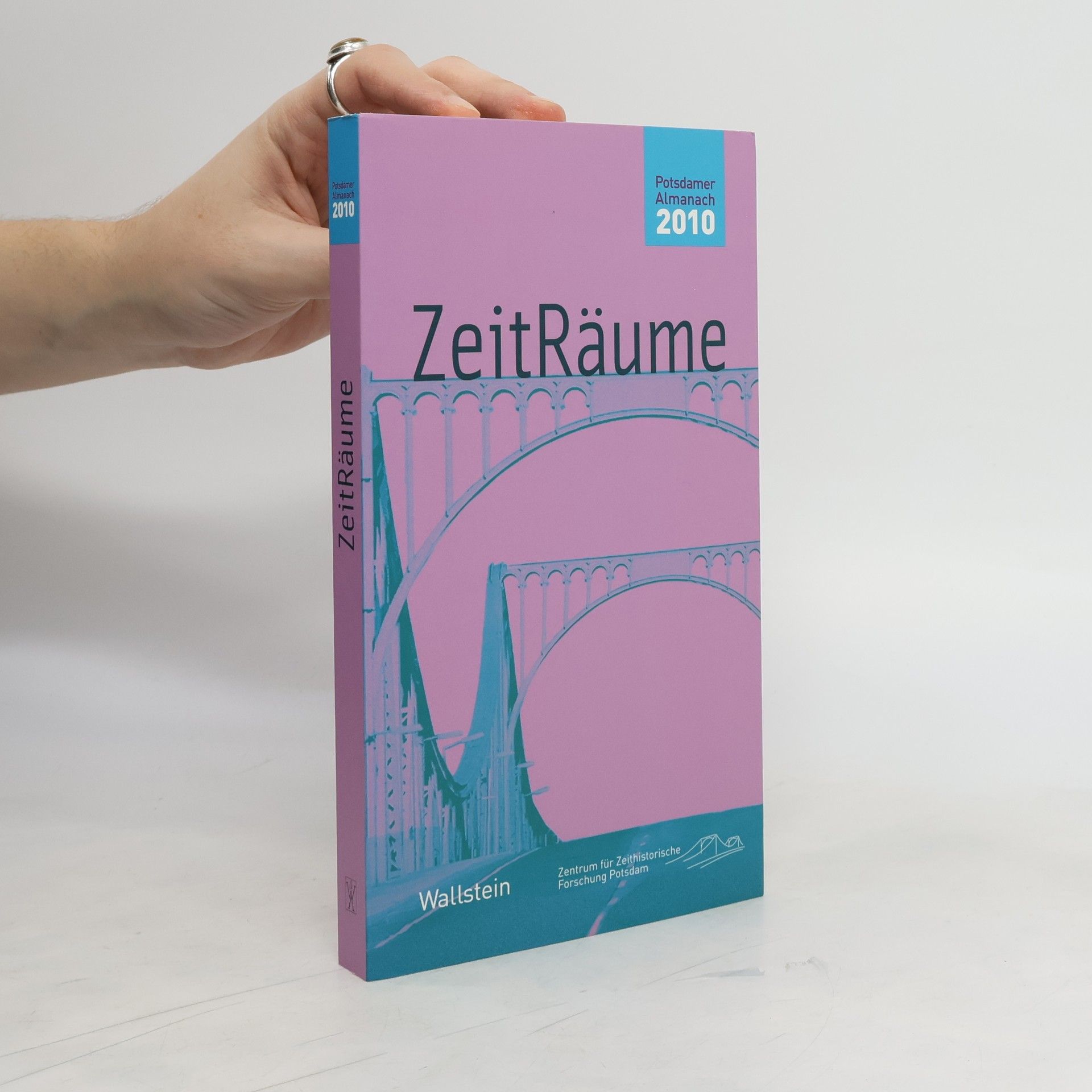
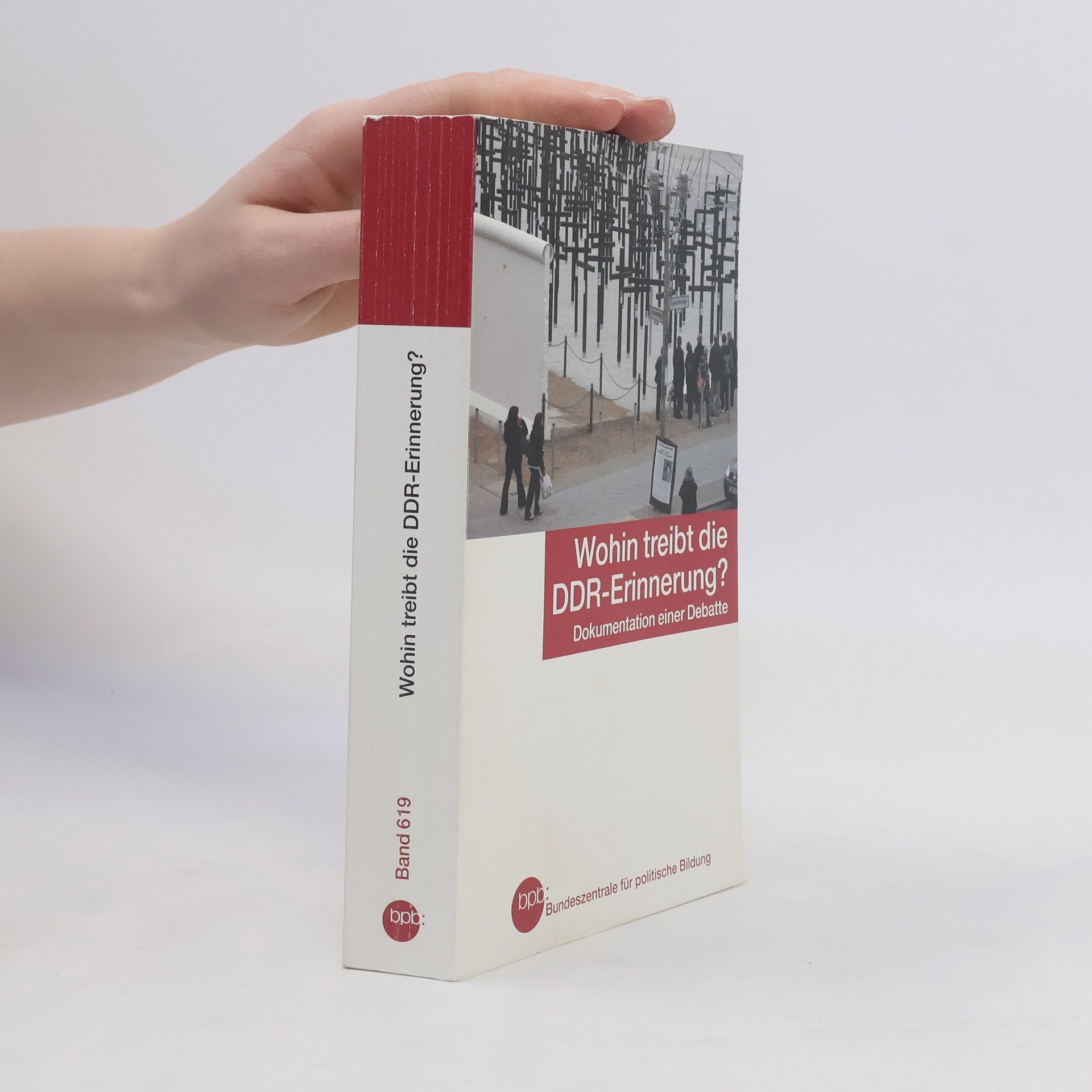

Wohin treibt die DDR-Erinnerung?
- 446pages
- 16 heures de lecture
Der Wert der Vergangenheit
- 151pages
- 6 heures de lecture
Der Umbruch von 1989 als zeitgeschichtlicher Endpunkt und Auftakt einer hoffnungsvollen wie problembelasteten Entwicklung der Gegenwart.Angesichts des unerwarteten Zusammenbruchs der staatssozialistischen Regime in Mittel- und Osteuropa stand die Chiffre »1989« lange Zeit für das Wunder einer weitgehend gewaltlosen Revolution, mit der die Tür zu einem Zeitalter des Friedens und der Freiheit aufgestoßen wurde. 30 Jahre später hingegen tritt immer deutlicher Der demokratische Aufbruch hat zwar politische und ökonomische Veränderungen in Ost(mittel)europa bewirkt. Doch langfristig wurden auch Entwicklungen in Gang gesetzt, die die moralischen Werte und politischen Ziele von damals wieder in Frage stellten und unerwartete Kontinuitäten offenbarten. Der Umbruch von 1989 bedeutet eben nicht nur den Endpunkt eines durch die Auseinandersetzung um Diktatur und Demokratie geprägten 20. Jahrhunderts. Er präsentiert sich rückblickend auch als Auftakt einer problembeladenen Entwicklung der Gegenwart, deren Ursachen weit hinter 1989 zurückreichen.