Petra Rösgen Livres

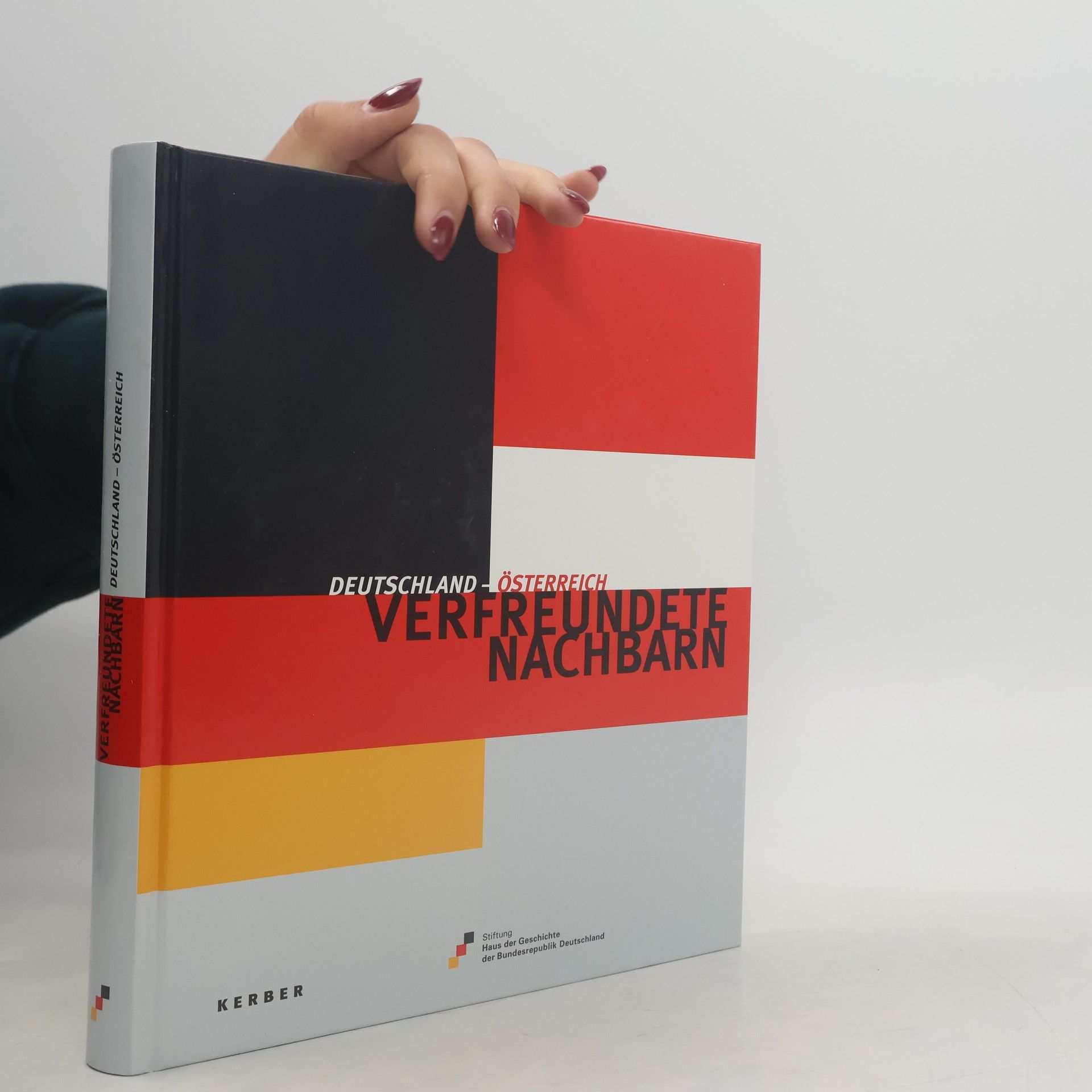
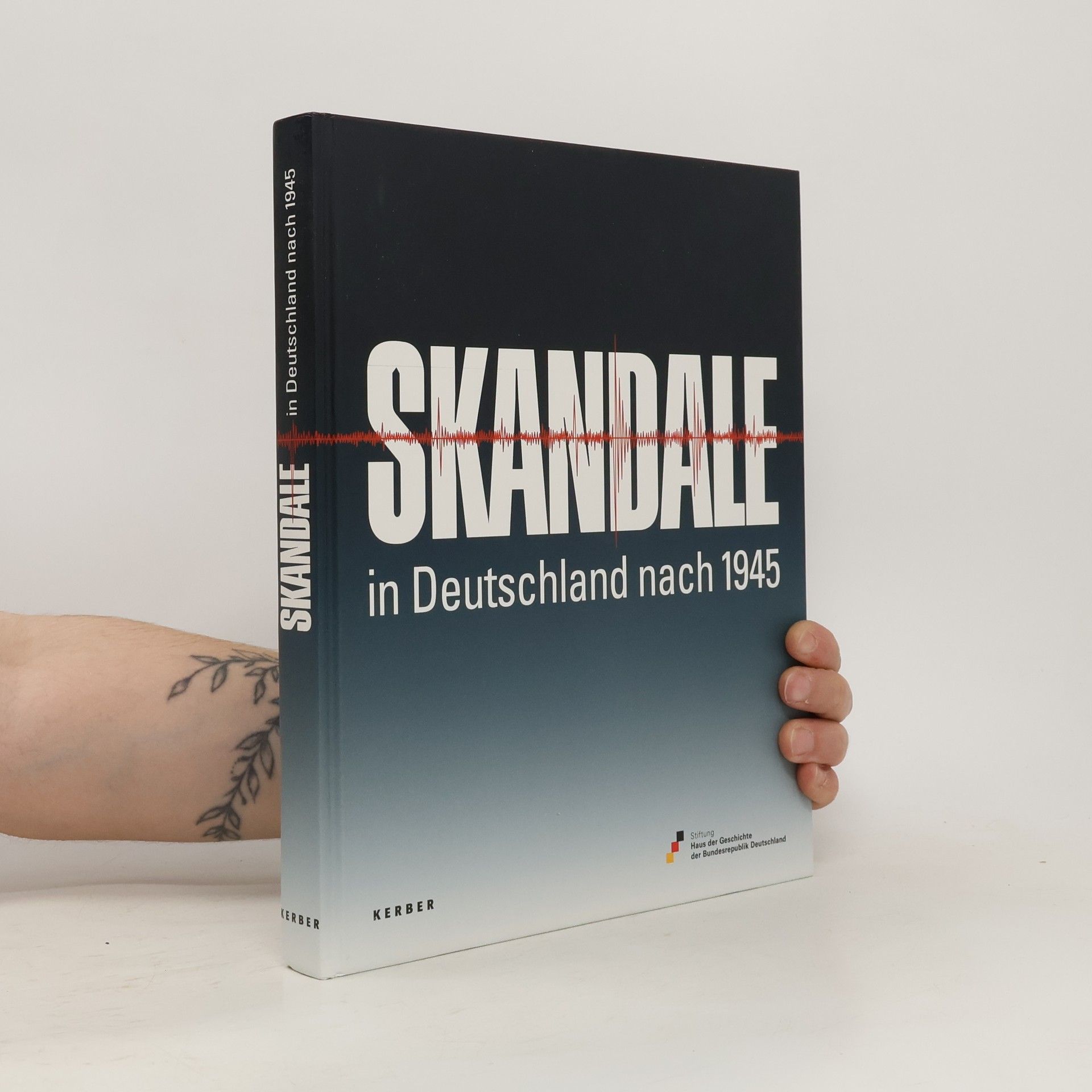
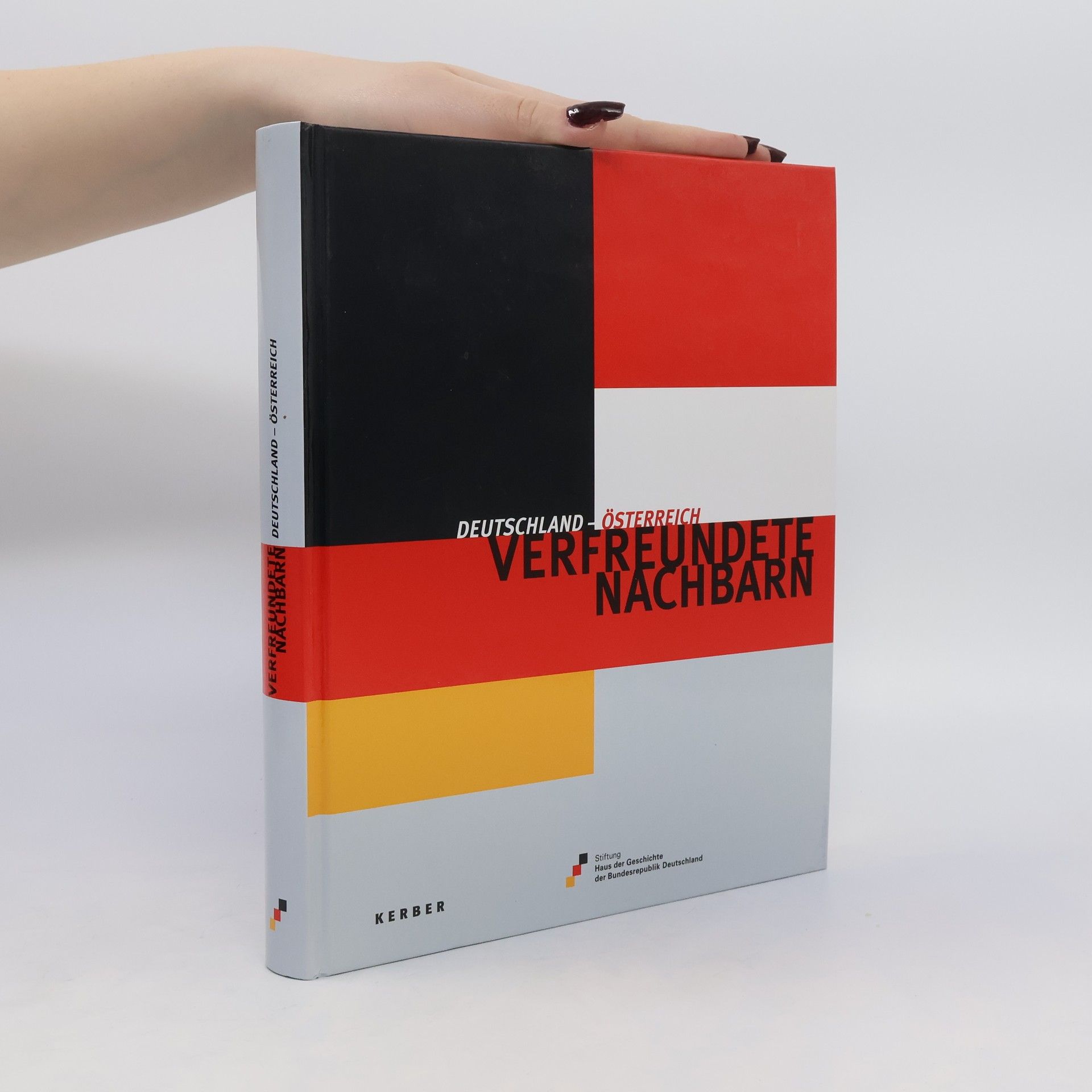
Skandale gibt es in allen Bereichen der Gesellschaft. Sie erlauben in ihrem jeweiligen historischen Kontext einen Blick auf die geltenden Normen. Anhand von zwanzig ausgewählten Fällen zeichnet das Buch eine Geschichte der Skandale nach. Der Bogen reicht vom Protest gegen den Film „Die Sünderin“ im Jahr 1951, in dem die katholische Kirche eine moralische Bedrohung sah, bis zum Fall „Mannesmann/Vodafone“, der zu Beginn des 21. Jahrhunderts für Empörung sorgte. Geraten Skandale an die Öffentlichkeit, zeigt sich, wie eine Demokratie Missstände korrigieren und was die Gesellschaft daraus lernen kann.
Die deutschösterreichischen Beziehungen, diese traditionsreiche, aber auch bedrückende, diese vielfältige und zeitweise so schreckliche Geschichte ist Thema des großzügig bebilderten Buches. Wie mit keinem anderen Nachbarland verbinden Deutschland und Österreich kulturelle und politische Gemeinsamkeiten, die auf eine jahrhundertelange Verbindung in der Reichsgeschichte zurückgehen und durch die gemeinsame Sprache gefestigt sind. Das Verhältnis beider Länder ist zugleich vom Trauma der NS-Zeit und der radikalen Trennung bestimmt, die nach 1945 unter dem Diktat der Besatzungsmächte zur politischen Neuformierung Deutschlands und Österreichs führte. Das Buch zeigt die politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Berührungspunkte, Kontinuitäten und Brüche im Verhältnis beider Länder auf. Es spannt den Bogen von 1804/1806, als sich mit der Etablierung eines österreichischen Kaisertums und dem Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation zum ersten Mal eine Tendenz zur Auseinanderentwicklung abzeichnete, bis zur aktuellen Situation, die seit dem Ende des Kalten Krieges in starkem Maße von der EU-Mitgliedschaft beider Länder geprägt ist.
Begleitbuch zur Ausstellung im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 3. Dezember 2003 bis 12. April 2004