Wagners Umgang mit den Instrumenten seiner Zeit war unkonventionell und kreativ. Aus dem Bayreuther Orchestergraben erklangen ungewohnte und neuartige Klänge. In der Oper wünschte sich der Komponist extra gefertigte Musikinstrumente und setzte sie oft nur als Attrappen ein. Überraschend ist auch, wie viele Klaviere und Flügel er sein Eigen nannte. Das Buch zeigt sämtliche Instrumente Wagners, von der Windschleuder bis zum Serpent. Farbige Fotos geben Einblick in seinen umfangreichen Fundus aus Tasten-, Schlag-, Blas- und Saiteninstrumenten.
Birgit Heise Livres
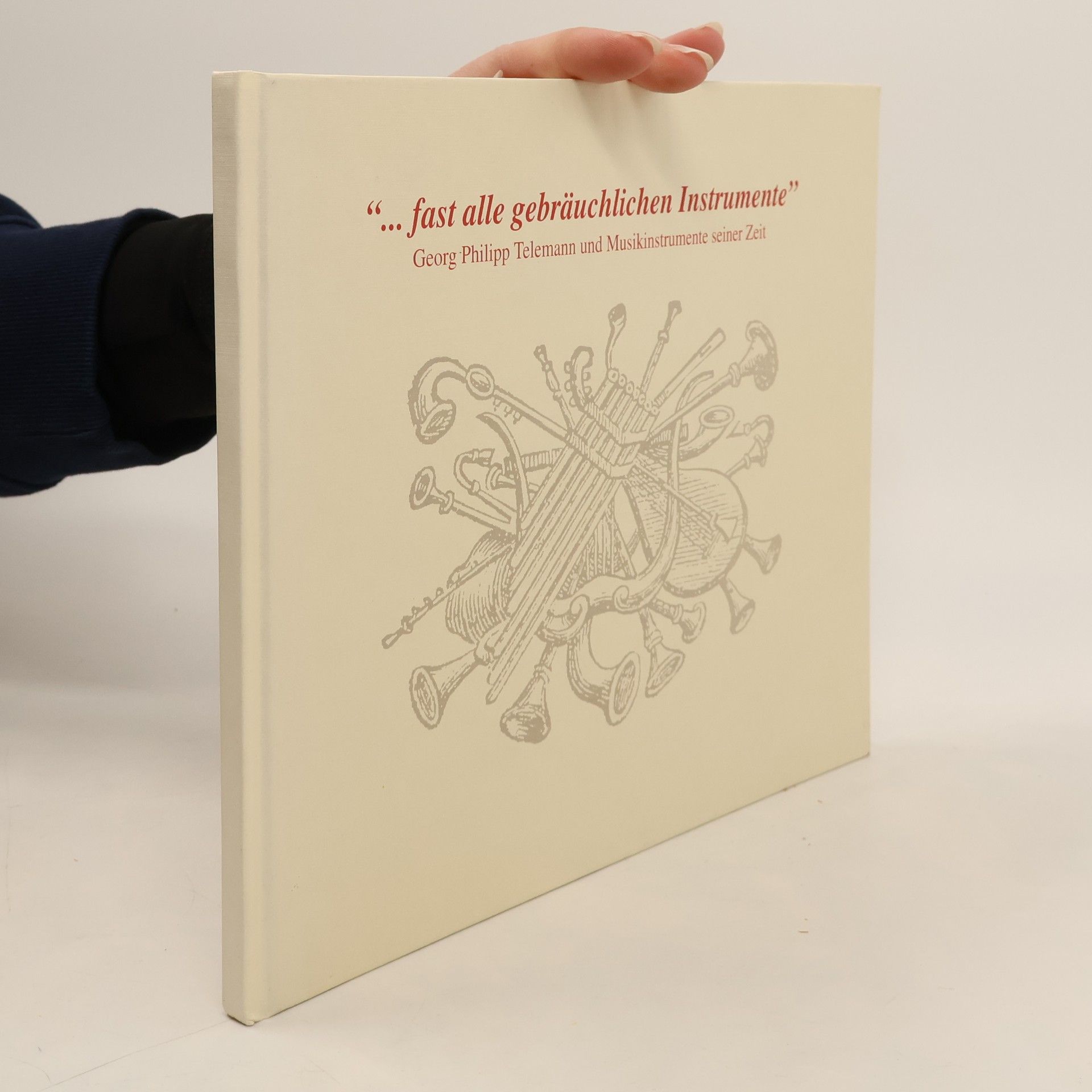


In Leipzig zeugen nur noch wenige Fabrikgebäude vom einstigen Ruhm der Stadt als Zentrum der industriellen Musikautomaten-Produktion. Zwischen 1880 und 1930 florierten dort 100 Fabriken, die begehrte klingende Standuhren, Leierkästen, Spieldosen und automatische Klaviere herstellten. Diese Produkte gehörten zum Mobiliar bürgerlicher Wohnzimmer, Kinderzimmer und Gaststätten. Der Beginn dieser Blütezeit war die Erfindung des Klavierbauers Paul Ehrlich, der 1882 das Patentrecht für die Ariston erhielt – eine kleine Harmonika mit leicht austauschbaren, günstigen Lochplatten. Damit begründete er einen neuen Industriezweig: die massenhafte Produktion von Musikautomaten. Anlässlich des Jahres der Industriekultur in Sachsen trafen sich im August 2020 zahlreiche Experten in den ehemaligen Symphonion-Werken in Leipzig-Gohlis, um über das Phänomen des Leipziger Musikautomatenbaus zu diskutieren. In diesem Buch sind die wesentlichen Ergebnisse zusammengefasst. Es behandelt kulturelle Hintergründe, stadtgeschichtliche Aspekte, juristische Fragen, die verschiedenen Ariston-Modelle sowie die aktuelle Digitalisierung und Archivierung der Automatenklänge. Mehrere Beiträge widmen sich Paul Ehrlich, seinen Produktionsstätten, Erfindungen, Musikinstrumenten und seiner Persönlichkeit.
... fast alle gebräuchlichen Instrumente
- 71pages
- 3 heures de lecture
Die Violine wird nach Orgel-Arth tractiret, Die Flöt' und Hautbois Trompeten gleich verspühret, Die Gamba schlentert mit, so wie das Bäßgen geht, Nur daß noch hier und da ein Triller drüber steht. Nein, nein, es ist nicht gnug, daß nur die Noten klingen, Daß du der Reguln Kram zu Marckte weist zu bringen. Gieb jedem Instrument das, was es leyden kan, So hat der Spieler Lust, du hast Vergnügen dran. Georg Philipp Telemann