"Sicherlich ist Laskers Ruhm heute hauptsächlich der Tatsache zu verdanken, daß er, als einziger Deutscher, siebenundzwanzig Jahre lang Schachweltmeister war (1894-1921); länger als jeder Weltmeister vor ihm oder nach ihm. Aber eine Verkürzung seines Lebens auf diesen Aspekt übersieht, daß Lasker mit ungewöhnlicher geistiger Vielseitigkeit auch auf anderen Gebieten schöpferisch und fruchtbar tätig war. Es ist die Aufgabe dieses Bandes, Laskers Lebenswerk in diesen Bereichen nachzugehen." Die Herausgeber
Michael Dreyer Livres
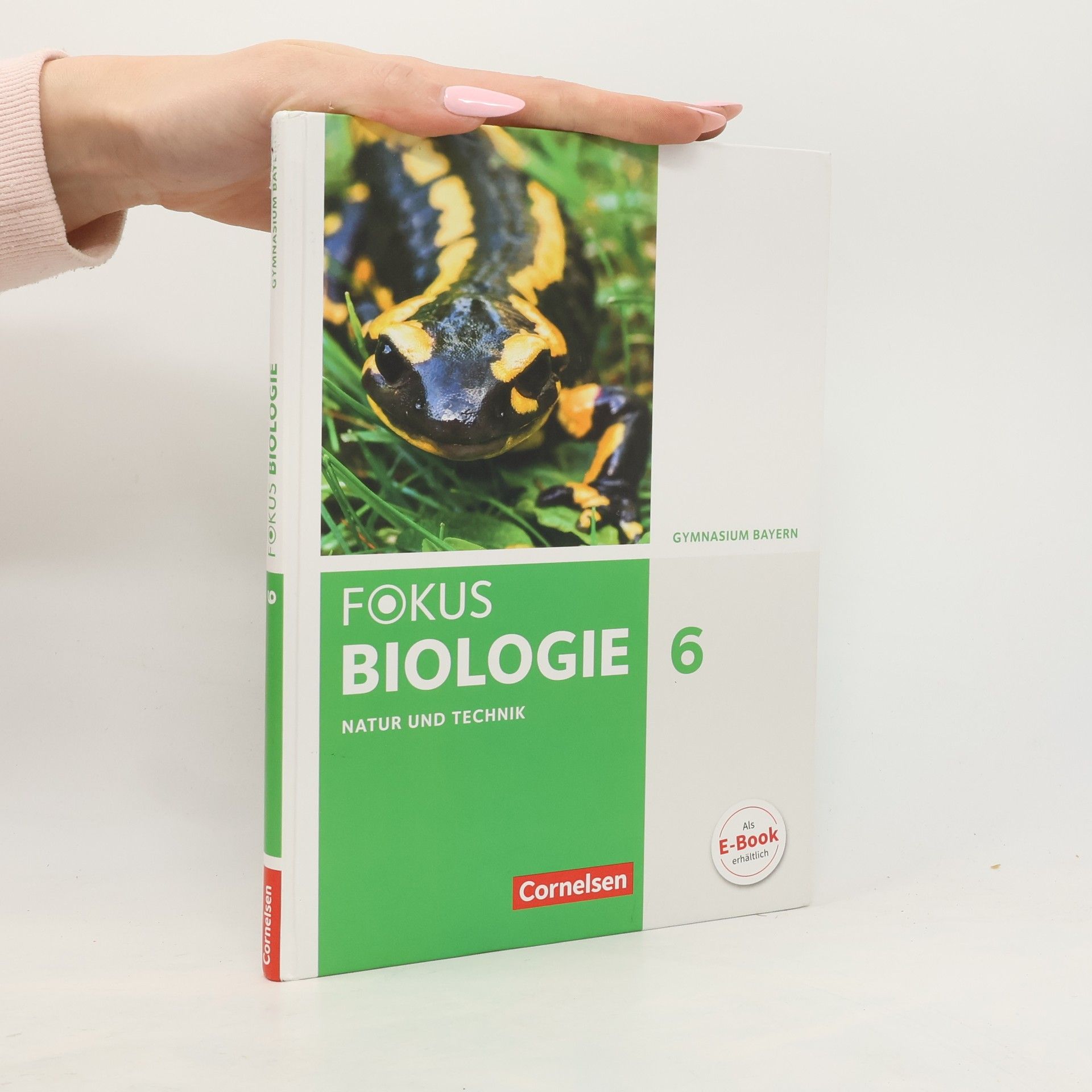
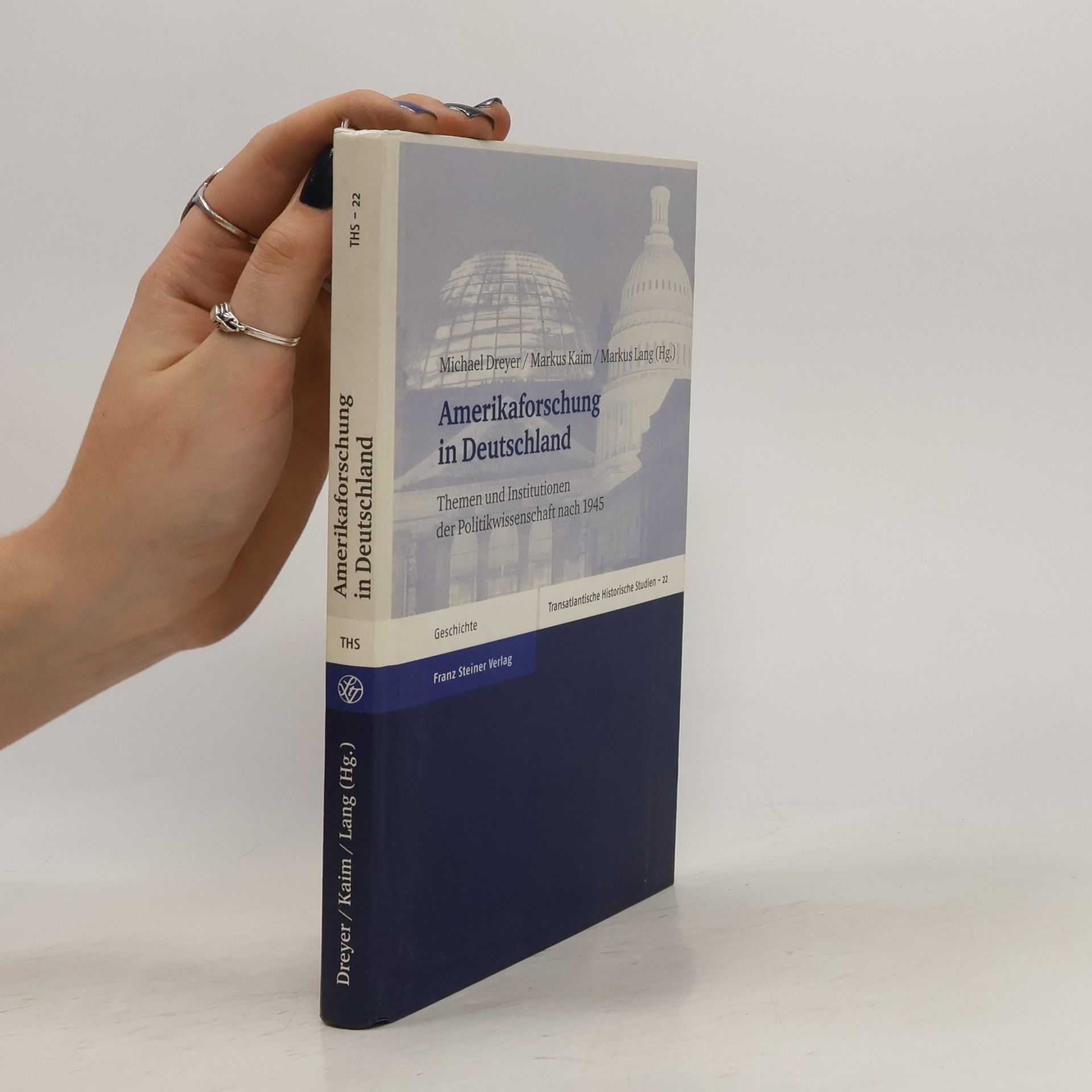

Amerikaforschung in Deutschland
Themen und Institutionen der Politikwissenschaft nach 1945
- 239pages
- 9 heures de lecture
Niemand bezweifelt, dass die USA für die Entwicklung der deutschen Politikwissenschaft (und Politik) eine wichtige Rolle gespielt haben. Aber wie sieht es mit der deutschen wissenschaftlichen Forschung über das politische System der Vereinigten Staaten selbst aus? In welchem Umfang haben deutsche Politikwissenschaftler diese Demokratie untersucht? Welche Fragestellungen haben sie aus der amerikanischen akademischen Landschaft übernommen? Was war aus wissenschaftlicher Perspektive an Amerika reizvoll, und welche Schwerpunkte haben sich herausgebildet? Der 50. Geburtstag der Deutschen Gesellschaft für Amerikastudien (DGfA) im Jahr 2003 war ein Anlass, dieser Frage nachzugehen. Die Beiträge dieses Bandes decken, wenn auch in unterschiedlicher Intensität, alle Teilbereiche der Politikwissenschaft ab und bieten einen inhaltlichen, aber auch einen organisatorischen Überblick über ein halbes Jahrhundert deutscher Forschung.
Gymnasium Bayern - 6: Fokus Biologie - Schülerbuch
- 184pages
- 7 heures de lecture
AufbauDie moderne, ansprechende und klare Gestaltung des Schulbuchs mit seinen schülergerechten Texten motiviert die Schüler/-innen zum Lernen und Wiederholen. Die neuen Kapiteleinstiegsseiten wecken durch spannende Fotos zum Thema das Interesse und helfen durch besondere Aufgaben den Vorwissenstand festzustellen. Zahlreiche weitere Aufgaben und Versuche regen zum praktischen und vor allem selbsttätigen Arbeiten an und unterstützen die Entwicklung fachspezifischer und allgemeiner Kompetenzen im Biologieunterricht. Knifflige Profi-Aufgaben erlauben einen differenzierenden Unterricht in heterogenen Klassen. Ausgewählte Lösungen im Anhang bieten den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich selbst zu überprüfen. Kompetenzorientierte Aufgaben am Ende eines jeden Kapitels fassen auf den Alles-klar?-Seiten die gelernten Inhalte und Fähigkeiten zusammen und fördern dabei ein vernetztes Denken. Im Grundwissen am Ende des Buches sind wichtige biologische Fachbegriffe verständlich und glossarartig zum einfachen Nachschlagen und Wiederholen zusammengestellt.