Europas Grenzen sind die tödlichsten der Welt. An den einstigen Markierungen kolonialer Gebiete treffen sich Leben und Tod, Humanität und Feindschaft, Lebensrettung und Alltagsrassismus. Migration als eine zentrale Frage der Gegenwart wirkt dabei auch ins Innere einer angespannten Gesellschaft: Wer darf zu uns kommen? Wer wird als illegal markiert? Wo verdichten sich Feindbilder? Heidrun Friese versteht derzeitige Migrationspolitiken als Teil eines Kriegsszenarios und zeigt deren innere Logik von Feindschaft und Todespolitik. Sie formuliert die existenzielle Frage nach der Universalität der Menschenrechte und plädiert für Verantwortung und Rechenschaftspflicht.
Heidrun Friese Livres
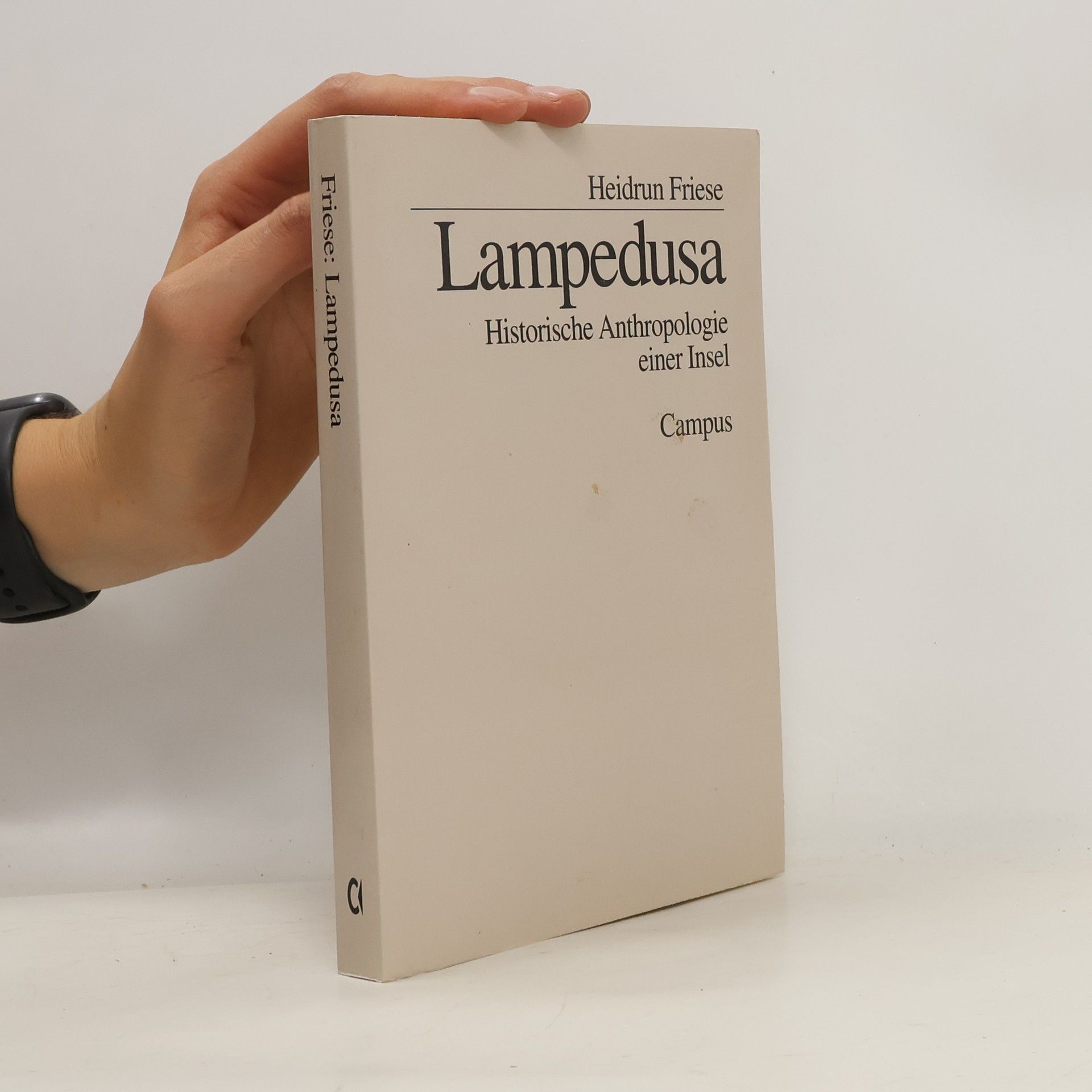
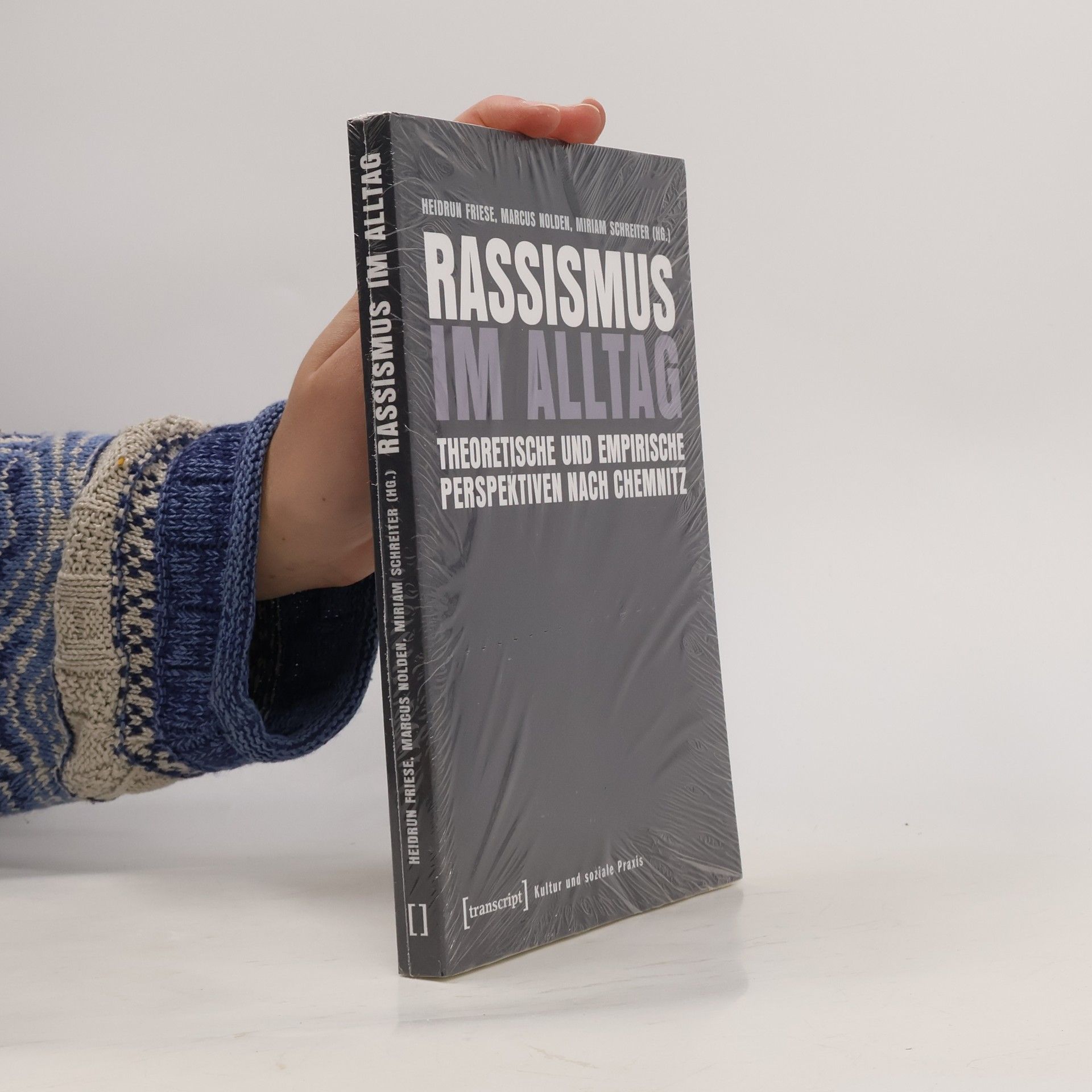

Proteste, aufgebrachte Bürger_innen und eine Stadt in Aufruhr - die Bilder von Chemnitz im Herbst 2018 haben die meisten noch vor Augen. Ereignissen wie diesen liegt ein deutschlandweites Phänomen zugrunde: ein Rassismus, der sich im Alltäglichen zeigt, in unangemessenen Bemerkungen, in Bildern und Diskursen, in sozialen Praktiken und Ausschlussmechanismen, in Gewalt und auch in Versuchen, ihn selbst zu leugnen. Die Beiträger_innen des Bandes setzen sich hiermit kritisch auseinander und analysieren aus unterschiedlichen Perspektiven die Mobilisierung rechter Szenen, antisemitischer Einstellungen, Hass und Radikalisierung in sozialen Medien sowie die Erfahrungen von Betroffenen. Damit werden Einblicke in die aktuelle Forschung ermöglicht, die auch engagierte Bürger_innen adressiert.
Im September 1843 verließen drei Schiffe den sizilianischen Hafen Porto Empedocle. An Bord befanden sich 120 Menschen, um die winzige und fast unbewohnte Insel Lampedusa, einstiges Feudalgut der Familie Tomasi, zu kolonisieren. Die historische Anthropologie der Insel rekonstruiert die Vergangenheit über die vielfältigen, fragmentarischen und nicht selten widersprüchlichen Erinnerungen ihrer heutigen Bewohner und verbindet sie mit Dokumenten aus dem Archiv. Sie nimmt in ihrem Versuch, ganz unterschiedliche Perspektiven für das Schreiben von Geschichte zu nutzen, zugleich die aktuellen Diskussionen - nicht nur der Geschichtswissenschaft - über Narrativität und Repräsentation auf und möchte den Raum möglicher Beschreibung weiter öffnen. Autorin: Heidrun Friese ist Anthropologin und lebt in Berlin.