Das Lehrbuch: Dieser Schwerpunkte-Band zum Verfassungsprozessrecht stellt in Anlehnung an die Lehrbücher zum materiellen Verfassungsrecht von „Degenhart, Staatsrecht I. Staatsorganisationsrecht“ und „Pieroth/Schlink, Grundrechte. Staatsrecht II“ die Grundbegriffe, Probleme und systematischen Zusammenhänge des zugehörigen Verfahrensrechts dar. Er vermittelt knapp, klar und einprägsam die prozessualen Voraussetzungen und Problemschwerpunkte von Verfassungsbeschwerde, Organstreitverfahren, abstrakter und konkreter Normenkontrolle und anderen verfassungsgerichtlichen Verfahrensarten.
Christian Hillgruber Livres


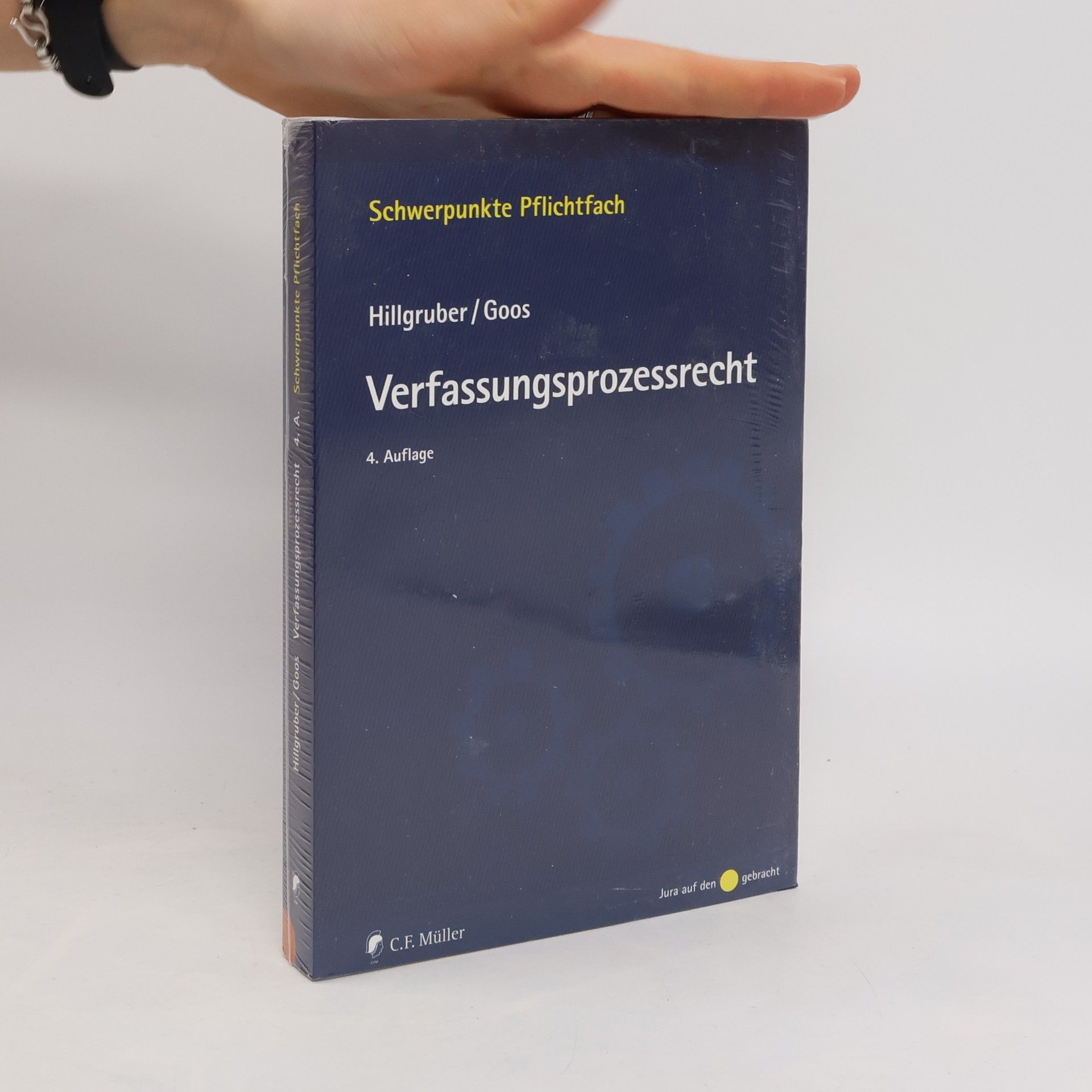
Kommentar zu den Staatskirchenverträgen der neuen Länder.
- 809pages
- 29 heures de lecture
Der Kommentar behandelt die Verträge, die in den 1990er und 2000er Jahren zwischen den neuen Ländern, den evangelischen Landeskirchen und dem Heiligen Stuhl auf Basis des Wittenberger Vertrages von 1993 geschlossen wurden. Dieser Vertrag hat sich als Modell für alle weiteren staatskirchenrechtlichen Verträge der dritten Generation etabliert. Der Kommentar beleuchtet das oft unterschätzte Vertragsstaatskirchenrecht dieser jüngsten Generation und bietet eine rechtsdogmatische Durchdringung sowie praxisgerechte Aufbereitung. Im Fokus steht der Wittenberger Vertrag, dessen Entstehungsgeschichte berücksichtigt wird, während vergleichbare Bestimmungen anderer Verträge ergänzend herangezogen werden. Eine vorangestellte Synopse erleichtert das Auffinden relevanter Regelungen. Das Inhaltsverzeichnis umfasst eine Einführung zu allgemeinen Rechtsfragen im Staat-Kirche-Verhältnis sowie eine detaillierte Auflistung der Artikel, die Themen wie Glaubensfreiheit, staatliche Theologenausbildung, Religionsunterricht, Kirchliche Hochschulen, Kirchensteuer und viele weitere Aspekte des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche behandeln.
Die Hohenzollerndebatte.
Beiträge zu einem geschichtspolitischen Streit.
Seit Sommer 2019 diskutiert die Offentlichkeit uber die Entschadigungsanspruche der Hohenzollern. Anlass fur die Forderungen ist die Enteignung des letzten deutschen Kronprinzen, Wilhelm von Preuaen, durch die Sowjetunion nach 1945. Allerdings sieht das einschlagige Gesetz vor, dass niemand entschadigt wird, der dem kommunistischen oder dem nationalsozialistischen System erheblichen Vorschub geleistet hat. Dass dieser Sachverhalt kaum einfach zu klaren ist, zeigen die vielen Facetten der Zunehmend verquicken sich moralische, politische, juristische und geschichtswissenschaftliche Aspekte. Das macht die offentliche Auseinandersetzung mitunter hochemotional und polemisch. Der Sammelband sorgt fur Differenzierung und Klarstellung. Beleuchtet werden die juristischen Hintergrunde ebenso wie die politischen Bezuge, auch die aktuelle Debatte unter Historikern uber das deutsche Kaiserreich findet Berucksichtigung. Und naturlich wird die politische Bedeutung des Kronprinzen fur den Aufstieg des Nationalsozialismus in den Blick genommen. 20 renommierte Autoren, darunter Peter Brandt, Oliver Haardt, Christian Hillgruber, Frank-Lothar Kroll, Lothar Machtan und Michael Wolffsohn, bieten mit diesem Buch ein differenziertes Fundament fur eine sachbezogene, multiperspektivische Diskussion uber die Hohenzollern.