Immer mehr Menschen beschleicht ein Unbehagen gegenüber dem Markt. Stetig wachsende Einkommensunterschiede, Gewinnsteigerungen durch Entlassungen, die schleichende Ökonomisierung des Lebens. Bildung wird durch Humankapitalbildung ersetzt, Politik auf Standortpolitik reduziert und Vorfahrt fürs Kapital als Vorfahrt für Arbeit verkauft. Und zu all dem noch müssen die Folgen, die die Gier des Kapitals und seiner Zu-diener angerichtet haben, von anderen ausgebadet werden. All dies wird von der vorherrschenden ökonomistischen Doktrin gerechtfertigt. Mehr Markt und mehr Wettbewerb, das sei doch letztlich immer gut für alle. Oder der Markt wird kurzerhand mit Freiheit gleichgesetzt, womit jede Verminderung seines Einflusses auf Unfreiheit hinausliefe. Trotzdem ist dies kein Anti-Markt-Buch, sondern ein Buch gegen die Marktgläubigkeit. Es geht darum, den Markt gesellschaftlich und politisch einzubinden, statt uns von ihm vereinnahmen zu lassen. Es geht darum, dass der Wettbewerbs-kampf eine geringere Rolle in unserem Leben spielt.
Ulrich Thielemann Livres
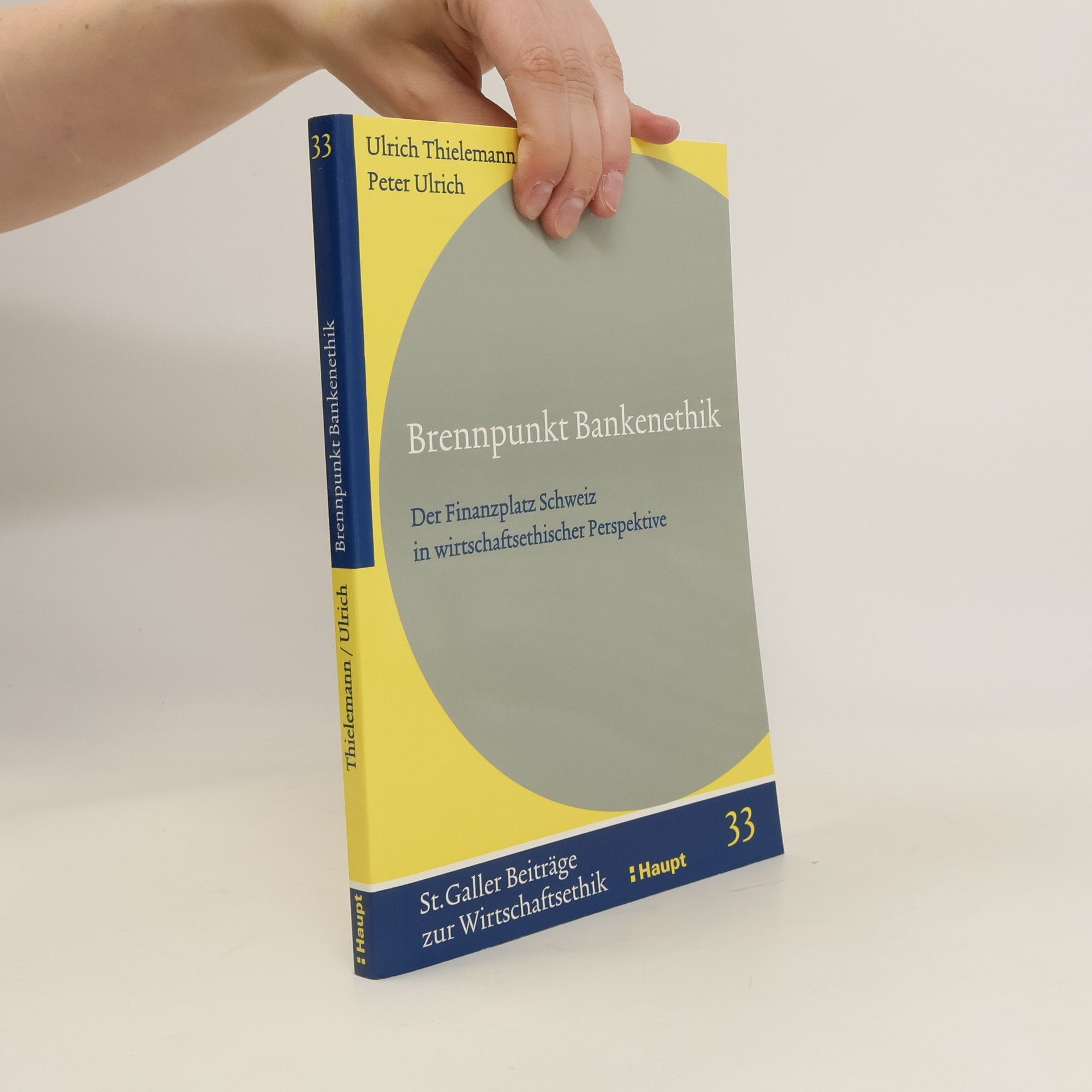

Brennpunkt Bankenethik
- 160pages
- 6 heures de lecture
Das Geschäft mit Geld ist eine besondere Branche, da es um das wichtigste Tausch- und Wertaufbewahrungsmittel geht. In der kapitalistischen Marktwirtschaft hat die Vermehrung dieses Mittels oft oberste Priorität, sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen. Begriffe wie 'Geldgier', 'Abzockerei' und 'kreative Buchführung' stehen zunehmend im Fokus öffentlicher Kritik. Zudem wird das schweizerische Bankgeheimnis häufig als ein Mittel zur Steuerhinterziehung betrachtet. Banken, als professionelle Akteure im Geldgeschäft, sehen sich neuen ethischen Fragen gegenüber. Diese Studie, im Auftrag der Truus-und-Gerrit-van-Riemsdijk-Stiftung, beleuchtet das Bankgeschäft aus einer moralischen Perspektive. Sie klärt grundlegende Kriterien für ethisch gutes Banking und bietet einen Überblick über verschiedene bankenethische Problemfelder. Darüber hinaus werden aktuelle Problemfälle exemplarisch analysiert. So wird eine wirtschaftsethische Reflexion für Leserinnen und Leser zugänglich gemacht, die im Alltag des Bankgeschäfts stehen.