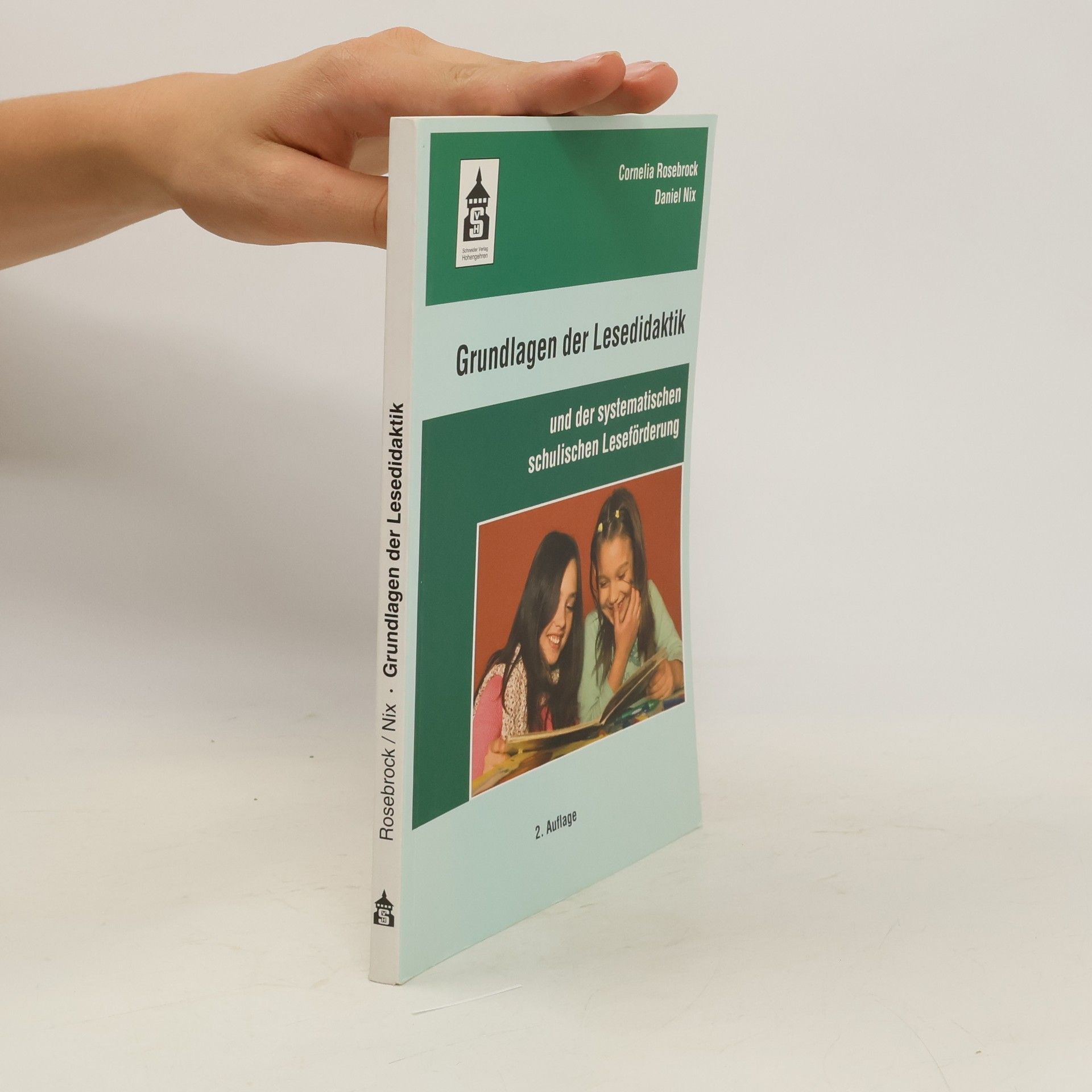„Leseförderung„ ist ein Sammelbegriff für ganz unterschiedliche Verfahren, um die Lesemenge, die Bereitschaft zum Lesen oder die Lernfähigkeit aus Texten bei Kindern und Jugendlichen zu steigern. In der vorliegenden Neubearbeitung der „Grundlagen der Lesedidaktik“ werden die verschiedenen Methoden und Ansätze der Leseförderung für die Klassenstufen 2-10 - praxisorientiert dargestellt, - im Blick auf die jeweiligen Zielgruppen analysiert, - auf Kompetenzen und die Bildungsstandards bezogen, - in ihrer Wirksamkeit bewertet und - systematisierend auf ihr gemeinsames Ziel, die Steigerung von Lesekompetenz, bezogen. Damit ist beabsichtigt, Lehrerinnen und Lehrern sowohl das nötige Grundlagenwissen der Lesedidaktik als auch Anwendungskriterien für das schulische Handeln an die Hand zu geben, mit deren Hilfe lesedidaktisch fundierter Unterricht in Deutsch und in den Sachfächern geplant werden kann. Schulen sollen auf diese Weise darin unterstützt werden, Lesedidaktik zu einer Querschnittsaufgabe aller Fächer und der Schulkultur zu machen. Der Band richtet sich vordringlich an Lehrerinnen und Lehrer im Fach Deutsch und in den verschiedenen textbasierten Sachfächern, auch an Lehramtsstudierende und Refrendar(innen). Darüber hinaus leistet er für das Feld der außerschulischen Leseförderung einen systematischen Überblick über die aktuelle Lesedidaktik und die praktischen Handlungsoptionen für unterschiedliche Zielgruppen.
Cornelia Rosebrock Livres