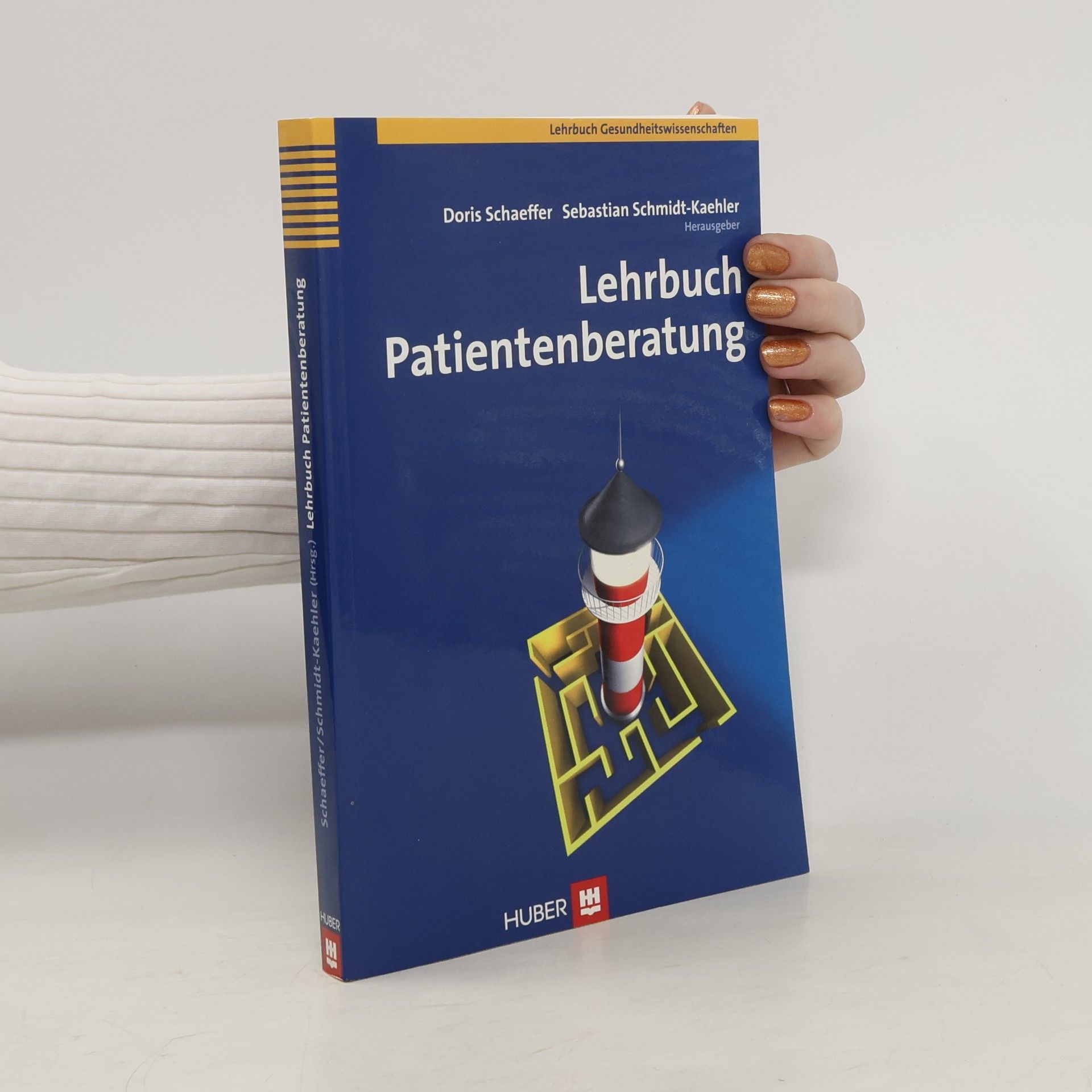Die Beratung von Patienten und Nutzern des Gesundheitswesens ist in Deutschland wie andernorts ein zunehmend wichtiges Praxisfeld, das angesichts gesundheitspolitischer und gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen zukünftig noch weiter an Bedeutung gewinnen wird. Patientenberatung leistet Orientierungshilfe im Dschungel der Versorgungsstrukturen, thematisiert die Rechte und Wahlmöglichkeiten der Patienten im Behandlungsgeschehen und vermittelt indikationsbezogene Informationen und Kompetenzen zum Umgang mit einzelnen Erkrankungen. In Zeiten der immer häufiger eingeforderten Eigenverantwortung der Patienten und der sich ausweitenden Entscheidungsspielräume kommt das Gesundheitswesen an einem hochwertigen Informations- und Kommunikationsangebot für seine Nutzer nicht mehr vorbei. Dieses Buch schließt eine Lücke in der deutschsprachigen Literatur, es legt den Stand der theoretisch-konzeptionellen Diskussion zur Patientenberatung übersichtlich dar, fasst methodische Strategien zusammen und vermittelt interessante Einblicke in die Praxis dieses jungen Aufgabenfeldes. Die Komposition von Beiträgen namhafter Experten aus dem In- und Ausland bietet eine systematische und interdisziplinäre Bestandsaufnahme, die den einschlägigen Ausbildungs- und Studiengängen als Lehrbuch dienen kann, Hilfestellung und Anregungen für Praktiker aufzeigt und neue Impulse für die Methoden- und Theorieentwicklung liefert.
Doris Schaeffer Livres