Gerlinde Lill Livres
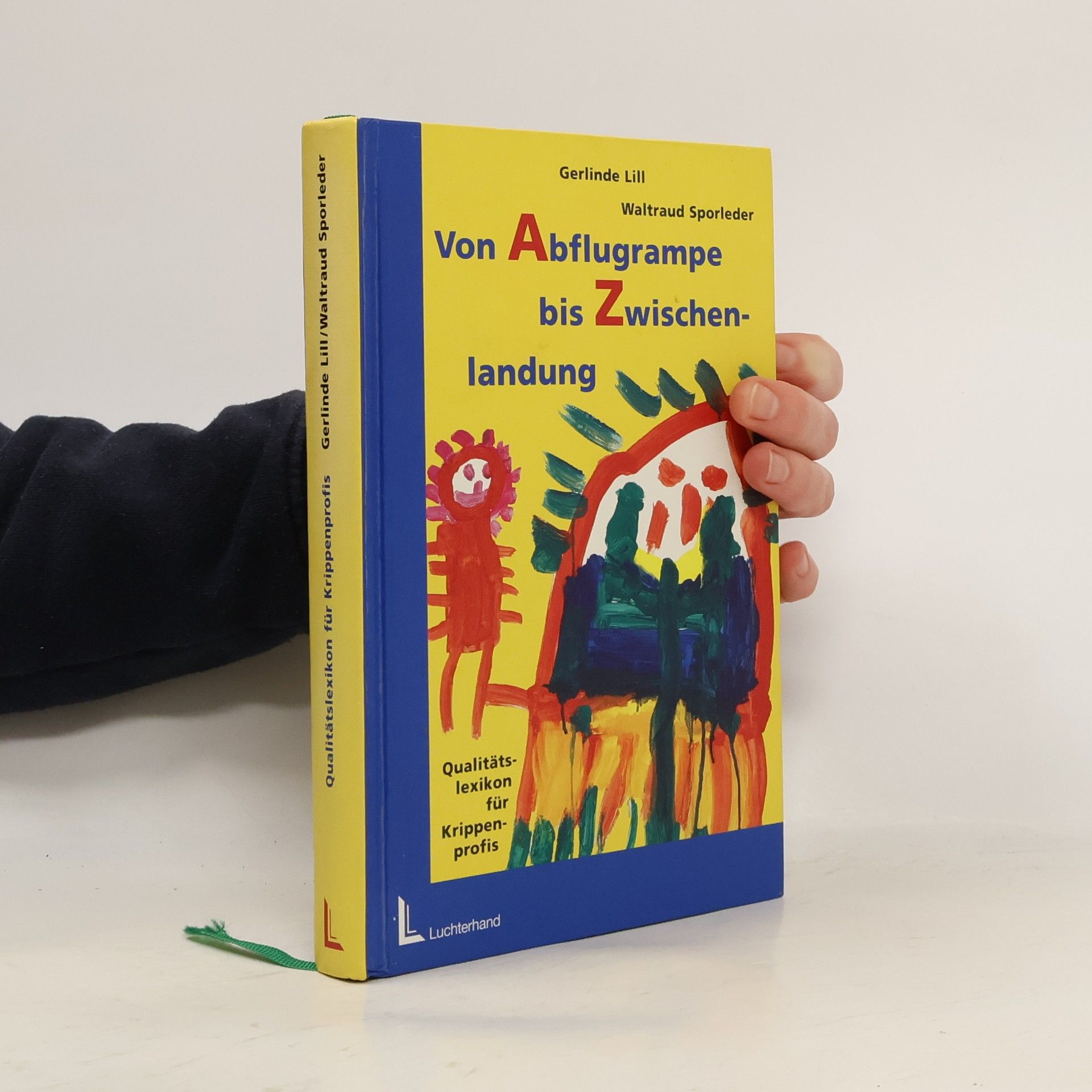


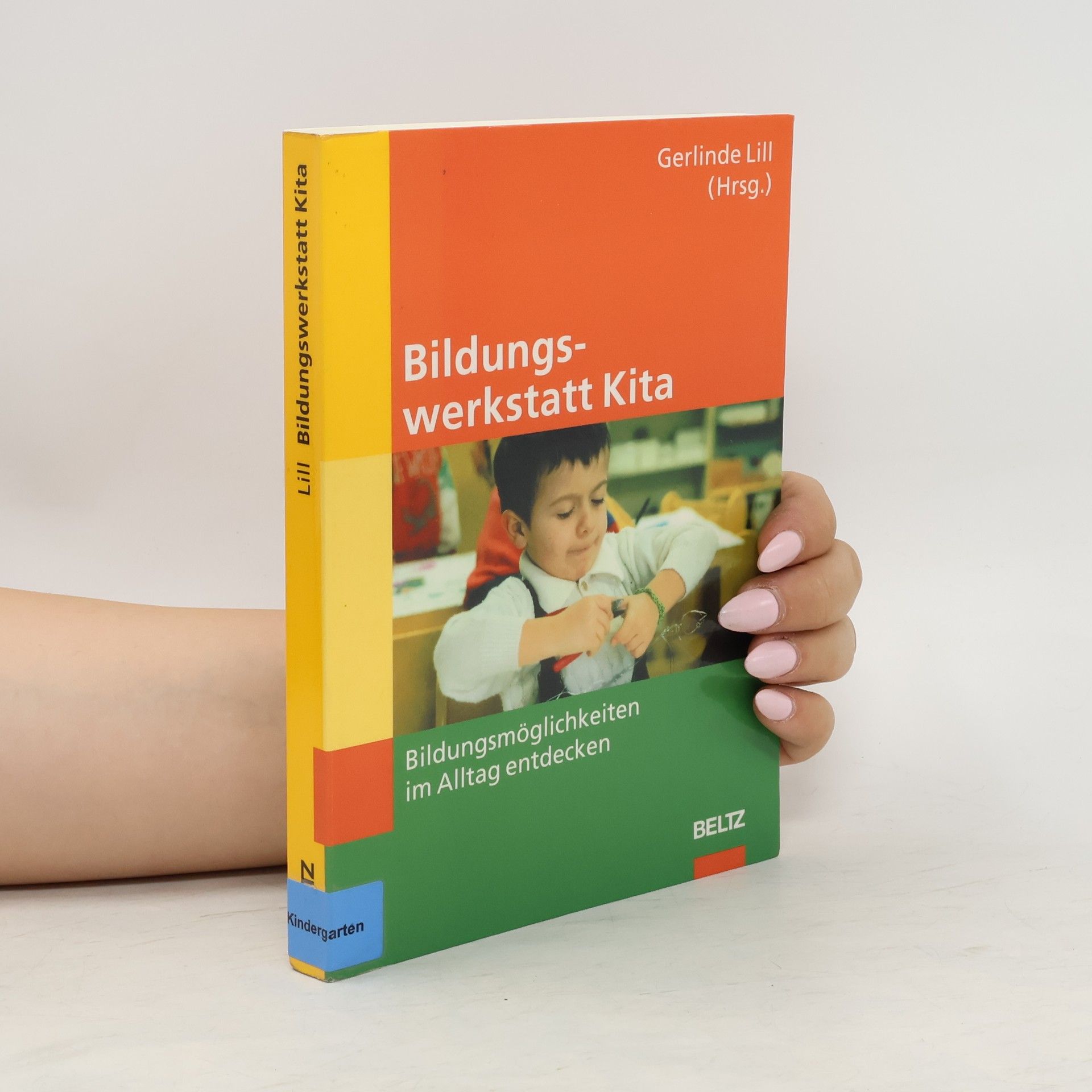
Von Abenteuer bis Zukunftsvisionen
- 348pages
- 13 heures de lecture
Das Krippenlexikon
Von Abenteuer bis Zuversicht
Das Krippenlexikon will Erzieherinnen, Tagesmütter, Tagesväter, Leiterinnen, Studierende, Lehrkräfte und Eltern anregen, sich mit Bildungsprozessen junger Kinder auseinander zu setzen. Es enthält 120 Stichwörter – von A wie Abenteuer bis Z wie Zuversicht – und versteht sich als Arbeitsbuch mit Streit- und Orientierungspotenzial, aber auch mit Unterhaltungswert. Die Idee, Stichwörter entlang des Alphabets aufzulisten und mal kurz, mal ausführlicher abzuhandeln, hat sich bewährt: Leserinnen und Leser können sich schnell Überblick über den Inhalt verschaffen und Texte gezielt herausgreifen. Ein Einblick in den Inhalt: A wie Achtsamkeit, Angebote B wie Beobachtung, Bewegung, Bildung D wie Dokumentation E wie Eingewöhnung, Elternabende F wie Fortbildungen G wie Gelassenheit H wie Höhlen und Nester I wie Individuelle Förderung K wie Kooperation L wie Lebensfreude M wie Morgenkreis N wie Neugier O wie Offene Arbeit P wie Pflege, Planung Q wie Quatsch machen R wie Regeln S wie Schlafen, Sprache T wie Transparenz U wie Übergänge V wie Verabschiedung W wie Wickeln Z wie Zuwendung