Der Aufbau des Buches folgt der Perspektive von Educational Governance. Diese Perspektive fokussiert einzelne Akteure der Organisation Schule. Die Governance der Schule erfasst neben einzelnen Akteuren auch die Akteurkonstellation. Sie kristallisiert sich heraus, wenn die Akteure nacheinander betrachtet werden.Zuerst werden Akteure vorgestellt, die weiter weg von der einzelnen Schule liegen. Dies sind Bildungspolitik, Bildungsmonitoring, Bildungsverwaltung. Es folgen Akteure, die etwas näher an der einzelnen Schule angelagert sind, wie die Schulaufsicht, Schulinspektion und Schulträger. Kommunales Bildungsmanagement und kritische Öffentlichkeit runden das Bild ab. Sodann werden Akteure vorgestellt, die in der einzelnen Schule tätig sind. Dies sind Steuergruppen, Schulleitungen, Lehrkräfte, und SchülerInnen. Der Blick auf Eltern rundet das Bild ab. Jeder einzelne Akteur wird gefragt, was er für die Schulentwicklung tun kann. Inhaltsverzeichnis Gesellschaftliche Betrachtung von Organisationen.- Formen von Organisationen.- Organisation von Inklusion und Ausschluss.- Organisation und Entwicklung.
Thomas Brüsemeister Livres
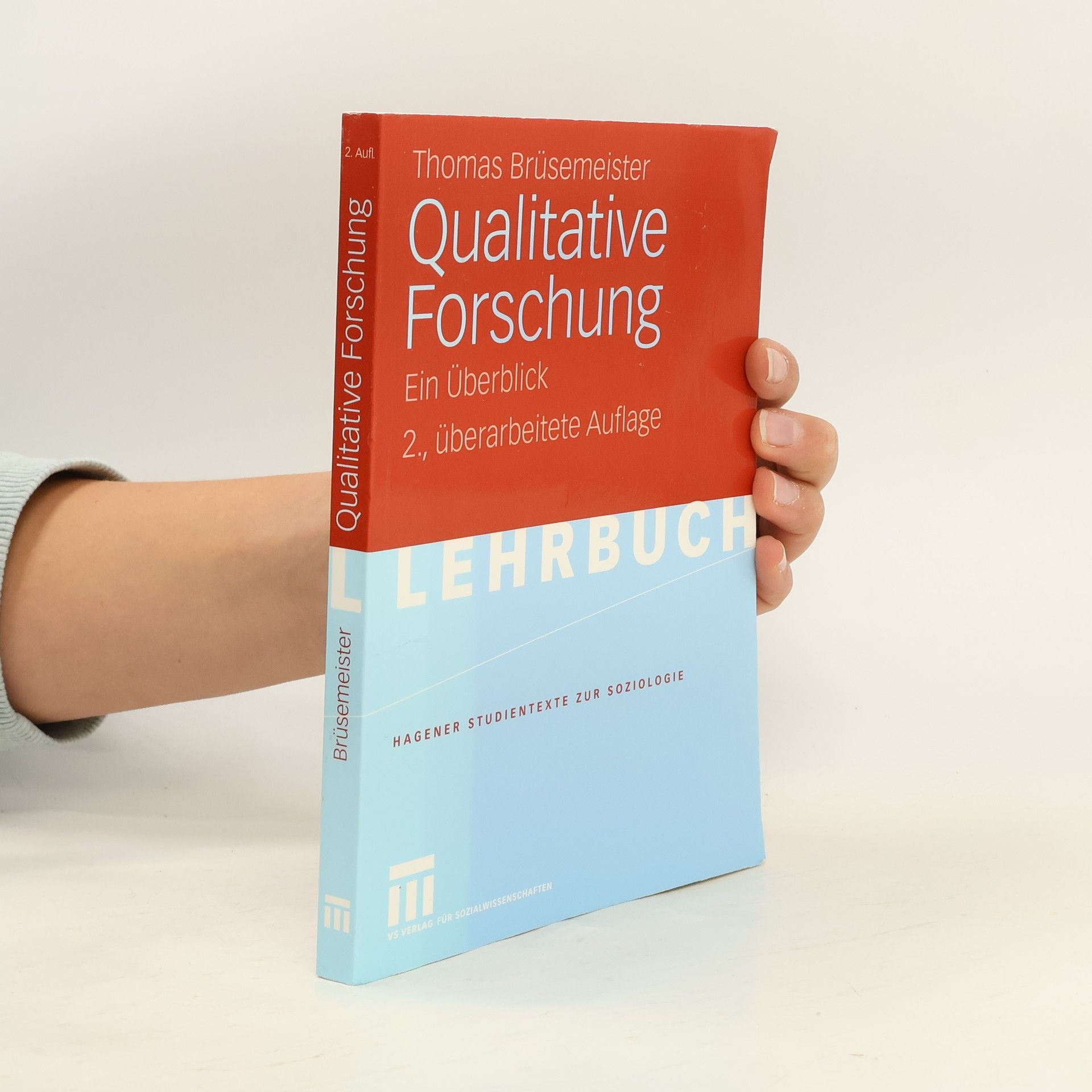
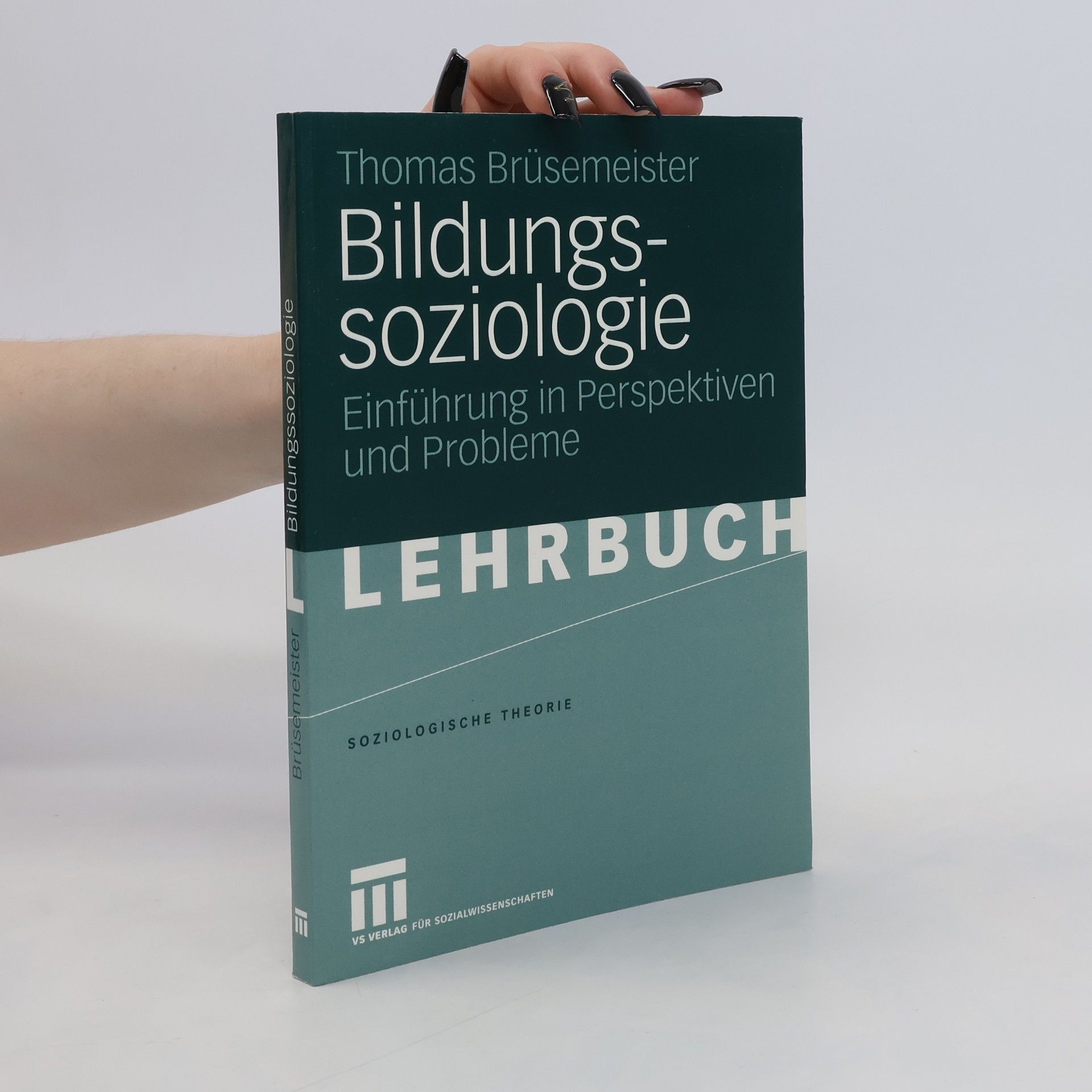

Bildungssoziologie
Einführung in Perspektiven und Probleme
Das Buch gibt einen Überblick über verschiedene Ansätze der Bildungssoziologie. Nach PISA ist das Interesse an bildungssoziologischen Erklärungen von Ungleichheitsdimensionen gestiegen. Die Perspektiven der Bildungssoziologie wurden jedoch schon weitaus früher entfaltet; teilweise können die in den 1970er Jahren entwickelten Modelle immer noch Relevanz beanspruchen. Zudem sind neuere Ansätze hinzugekommen. Wie im Buch gezeigt wird, stehen heute institutionen- und sozialisationstheoretische, ungleichheits- und differenzierungstheoretische, entscheidungstheoretische, phänomenologische und organisationsbezogene Konzepte als Perspektiven der Bildungssoziologie zur Verfügung, die auch von anderen Disziplinen genutzt werden können.
Hagener Studientexte zur Soziologie: Qualitative Forschung
Ein Überblick - 2., überarbeitete Auflage
- 242pages
- 9 heures de lecture
Dieses Buch stellt Grundzüge von fünf Verfahren der qualitativen Forschung vergleichend · qualitative Einzelfallstudien,· narratives Interview,· Grounded Theory,· ethnomethodologische Konversationsanalyse· und objektive Hermeneutik.Die Darstellung beginnt mit qualitativen Einzelfallstudien, bei denen Beschreibungen von Daten im Mittelpunkt stehen. Am Ende werden Methoden diskutiert, die ihren Gegenstand stärker theoretisch deuten. Alle Verfahren werden weitgehend aus Sicht der Anwendungspraxis geschildert.