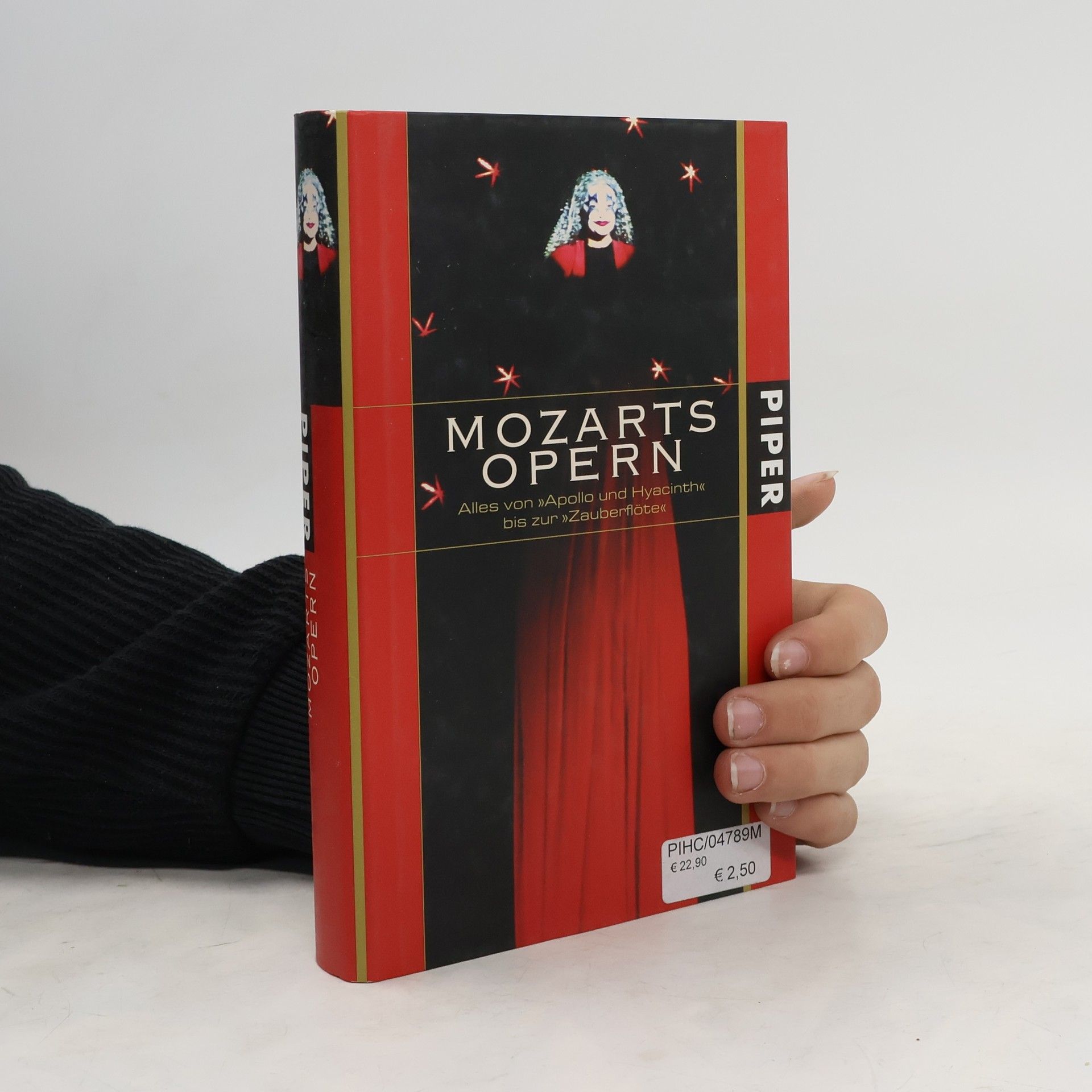Gluck, der Reformer?
Kontexte, Kontroversen, Rezeption - Nürnberg, 18.-20. Juli 2014- (Symposiumsbericht)
- 105pages
- 4 heures de lecture
Die Tagung "Gluck, der Reformer?" beleuchtet die weitverbreitete Wahrnehmung von Christoph Willibald Gluck als bedeutenden Opernreformator, insbesondere im Kontext seiner Reformwerke seit 1750. Die Beiträge bieten eine umfassende Analyse der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Glucks künstlerischer Prägung und seiner Rezeption im 20. und 21. Jahrhundert. Dabei wird das Interesse an Glucks Gesamtwerk betont, das über die bekannten Reformwerke hinausgeht, und es werden neue Perspektiven auf seine Bedeutung für die Opernlandschaft aufgezeigt.