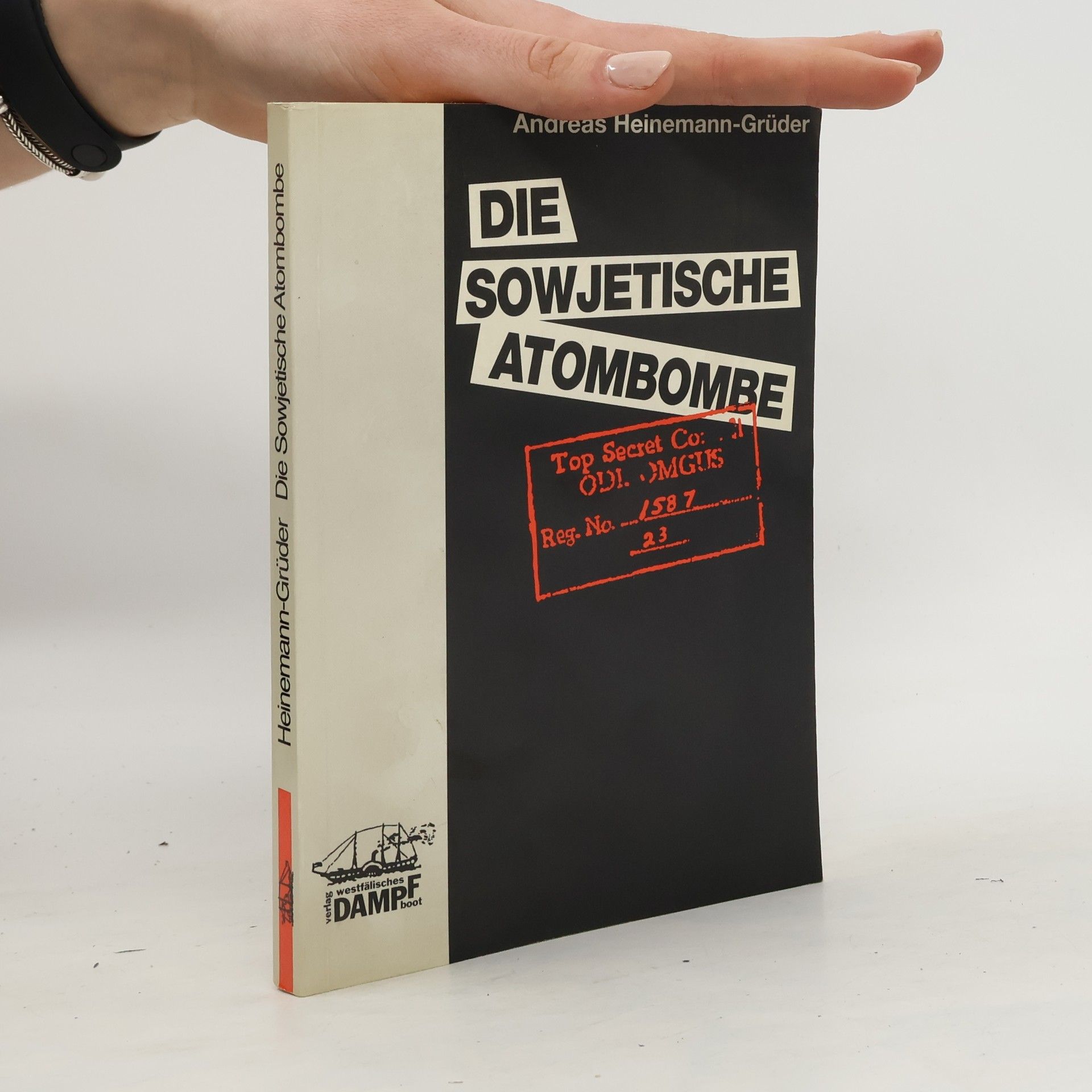Lehren aus dem Ukrainekonflikt
Krisen vorbeugen, Gewalt verhindern
Der Euro-Maidan in der Ukraine, die Annexion der Krim und der von Moskau unterstützte Separatismus im Donbass haben die intensivste Krise der Ost-West-Beziehungen seit 1989/90 ausgelöst. Die Deutung des Ukrainekonfliktes ist umkämpft und Teil des globalen Wettbewerbs zwischen autokratischen und offenen Gesellschaften. Die Konfrontation mit Russland beruht auf grundlegenden Werte- und Interessenkonflikten, die die Aussicht auf vertrauensvolle Beziehungen trüben. Russland beansprucht einen Sonderstatus in den internationalen Beziehungen und wendet sich zunehmend Asien zu, während der Westen die post-sozialistischen Staaten in seinen Einflussbereich ziehen möchte. Die Demokratisierung und Westorientierung dieser Staaten stellt eine Bedrohung für die Herrschaft Putins dar. Die EU hat bisher nur begrenzte strategische Handlungsfähigkeit, und die NATO schützt ihre Mitglieder, jedoch nicht die Beitrittskandidaten. Mit dem zeitlichen Abstand zur aktiven Kriegsphase ist es wichtig, Schlussfolgerungen für die Sicherheitspolitik, die Konfliktprävention und das Krisenmanagement zu ziehen. Internationale Experten erörtern Lehren für die Früherkennung, die Kommunikation mit der russischen Führung sowie für die EU, die OSZE und die NATO.