Klaus Welke Livres

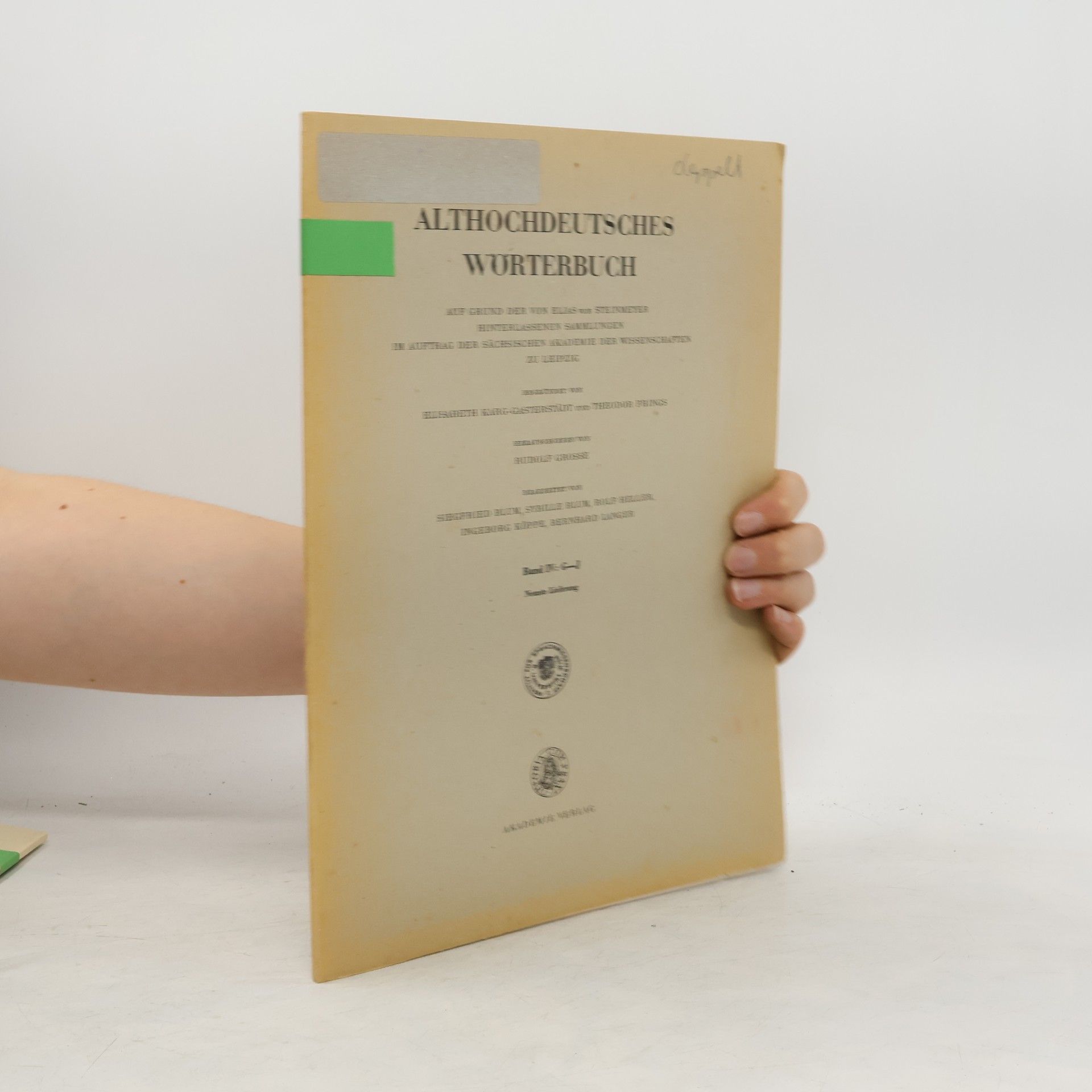
Die prototypentheoretische und signifikativ-semantische (semasiologische) Orientierung der Konstruktionsgrammatik (KxG) durch George Lakoff und Adele Goldberg (Berkeley Cognitive Construction Grammar) wird am Beispiel des Deutschen in Richtung auf eine tätigkeitsbezogene (sprachgebrauchsbezogene) Grammatiktheorie ausgebaut, jenseits des Competence-Performance-Dualismus bisheriger Syntaxtheorien. Teil I entwirft eine konstruktionsgrammatische Beschreibung der Grammatik von Sätzen mit einfachen (nicht-komplexen) Prädikaten im Wechselverhältnis von Konstruktion und Projektion (Valenz) unter dem Primat der Konstruktion. Aus diesem Wechselverhältnis erklärt sich die Kreativität der SprecherInnen/HörerInnen beim Operieren mit Argumentkonstruktionen und die Produktivität syntaktischer Strukturen (Konstruktionen). Eingeschlossen ist die Beschreibung der Fusion von Modifikatorkonstruktionen und der Einbettung von Substantivkonstruktionen sowie eine konstruktionsgrammatische Interpretation der Variabilität von Wortfolgen. Im Teil II wird das deklarative Vererbungskonzept der KxG zu Gunsten eines sprachgebrauchsbezogenen Konzepts von Vererbung revidiert. Grammatiktheoretisch zentrale Phänomene wie Passivierung, Medialisierung, Nominalisierung und die Entstehung von Präpositionalobjekt-Konstruktionen und Partikel- und Präfixkonstruktionen werden auf dieser Grundlage als Konstruktionsvererbung erklärt.