Kann man den Medien nicht mehr trauen? Der Kampfbegriff »Lügenpresse« markiert das Extrem eines Vertrauensverlusts, dem der Journalismus schon länger unterliegt. Den Medien wird von vielen nicht mehr zugetraut, die Bürger wahrheitsgetreu zu informieren. Sie stehen im Verdacht, heikle Informationen, z.B. über Muslime und Flüchtlinge, zu unterschlagen. Den Journalisten wird unterstellt, willfährige Sprachrohre der Regierenden zu sein. Manipulation und politische Kampagne sind weitere Reizworte. Solche Urteile treffen insbesondere die öffentlich-rechtlichen Sender, aber auch die privatwirtschaftlichen Medien, und sie werden immer rabiater geäußert. Wie ist diese Glaubwürdigkeitskrise entstanden? Wieso sind plötzlich so viele Leser und Zuschauer verunsichert? Was sind die politischen Hintergründe? Die Autoren unternehmen eine spannende Spurensuche und skizzieren, was Journalisten gegen die Verunsicherung tun können. Mit Beiträgen von Giovanni di Lorenzo, Jakob Augstein, Klaus Brinkbäumer, Heribert Prantl u.a.
Volker Lilienthal Livres
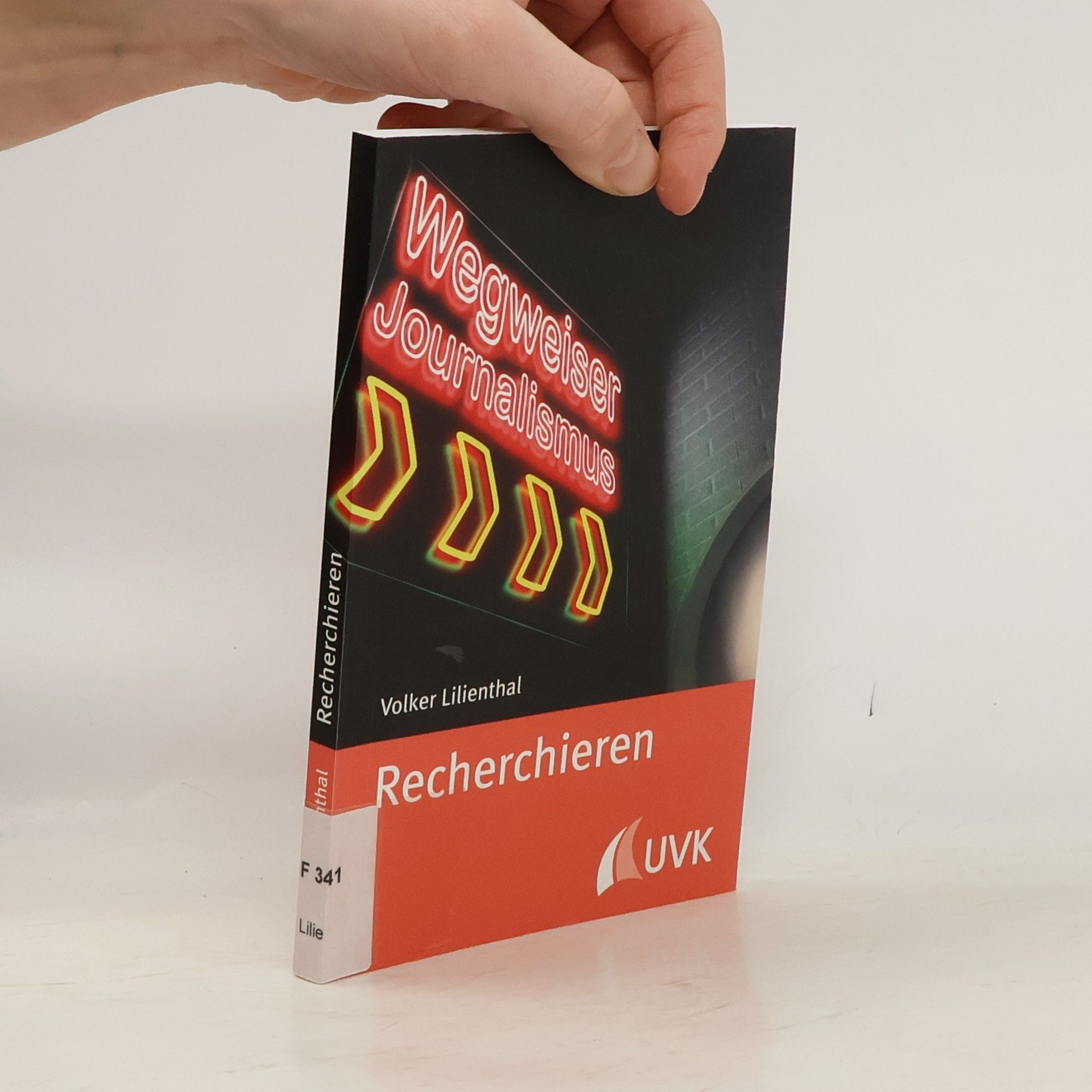
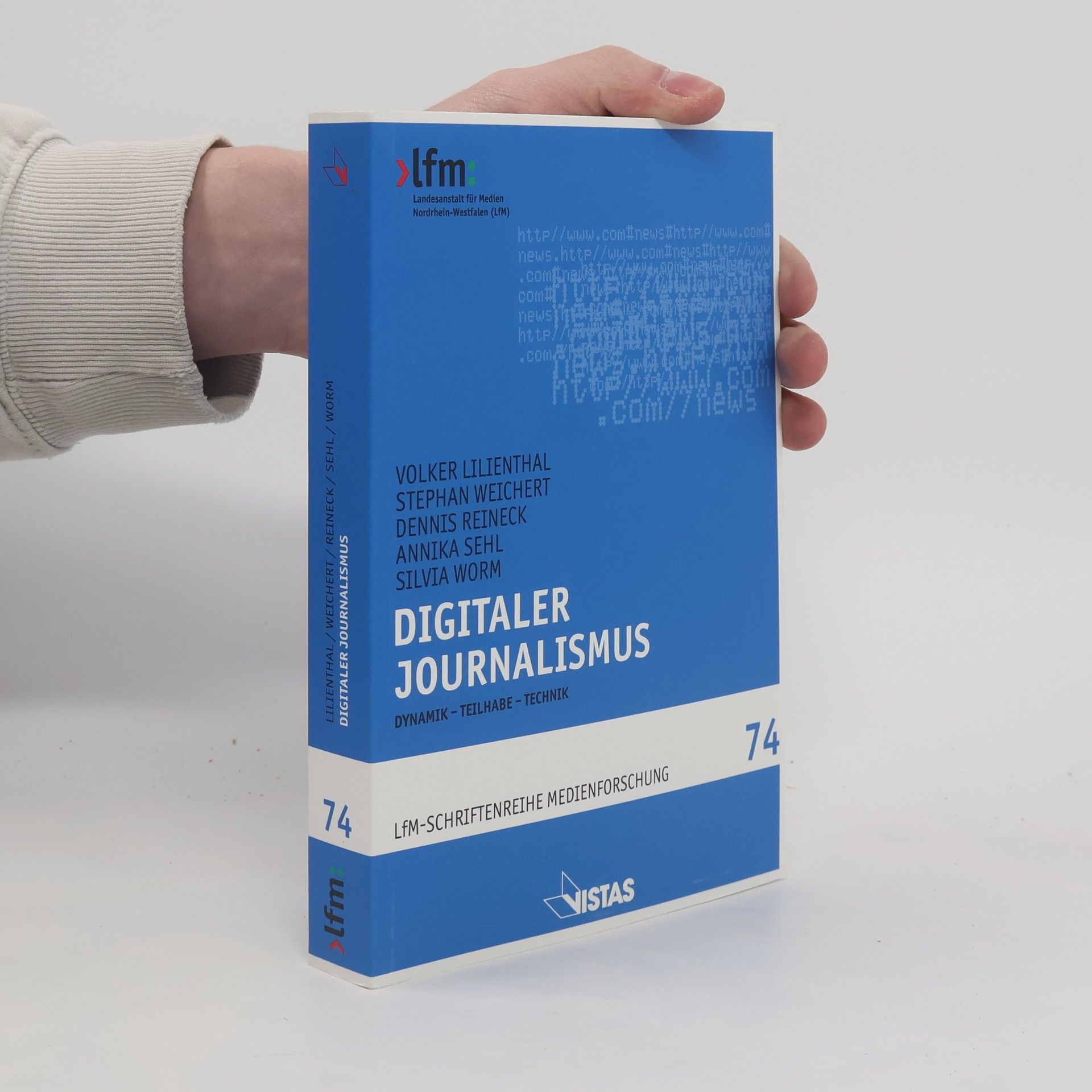
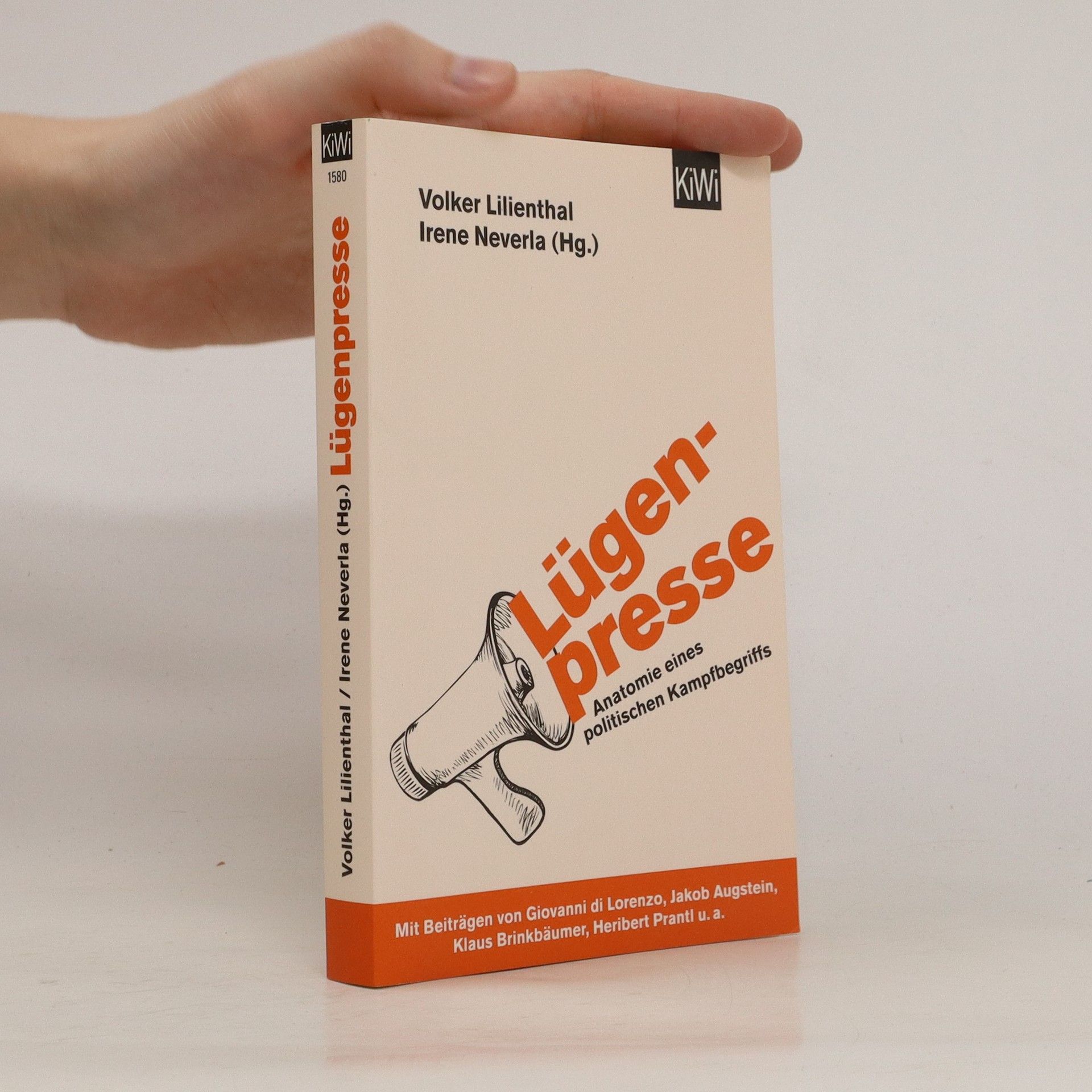
Die vorliegende Studie behandelt die Frage, inwieweit sich der Digitale Journalismus inzwischen professionalisiert hat, welche Rolle die Teilhabe des Publikums und die technische Automatisierung in den Redaktionen spielen. Um die Dynamik des Digitalen Journalismus theoretisch und praxisadäquat reflektieren zu können, baut die Untersuchung auf einem breit angelegten methodischen Design auf. Der Band leistet eine wissenschaftliche Positionsbestimmung neuer kommunikativer Leistungen, identifiziert Entwicklungspotenziale insbesondere bei der Einbindung des Publikums und technischer Innovationen im Journalismus, nimmt aber auch Herausforderungen und Risiken in den Blick. Anhand der Studienergebnisse werden Handlungsempfehlungen und Lösungsoptionen für die Medienpraxis formuliert
Wegweiser Journalismus: Recherchieren
- 142pages
- 5 heures de lecture
'[...] äußerst praxisnah und besonders gut im Redaktionsalltag zu nutzen.'§(MedienMAGAZIN)§§'das Werk [gibt] zahlreiche wertvolle Einsteigertipps, die sich auch hervorragend für Blogger eignen'§medienmilch.de§§'geballtes Wissen, [das] man verinnerlichen sollte, bevor man sich [...] in die berichtende Zunft [...] begibt.'§filmtogo.net§§'Das Basiswissen des Recherchierens wird kompakt und verständlich vermittelt, zahlreiche Beispiele helfen, die jeweiligen Ausführungen klarer zu erfassen und besser zu verstehen.'§Deutscher Fachjournalisten Verband§§'Lesenswert und auch für alte Hasen interessant.'§BJVreport