Eine Welt für sich
Leben und Arbeiten in der Wichern Diakonie Frankfurt (Oder) von 1945 bis 1989
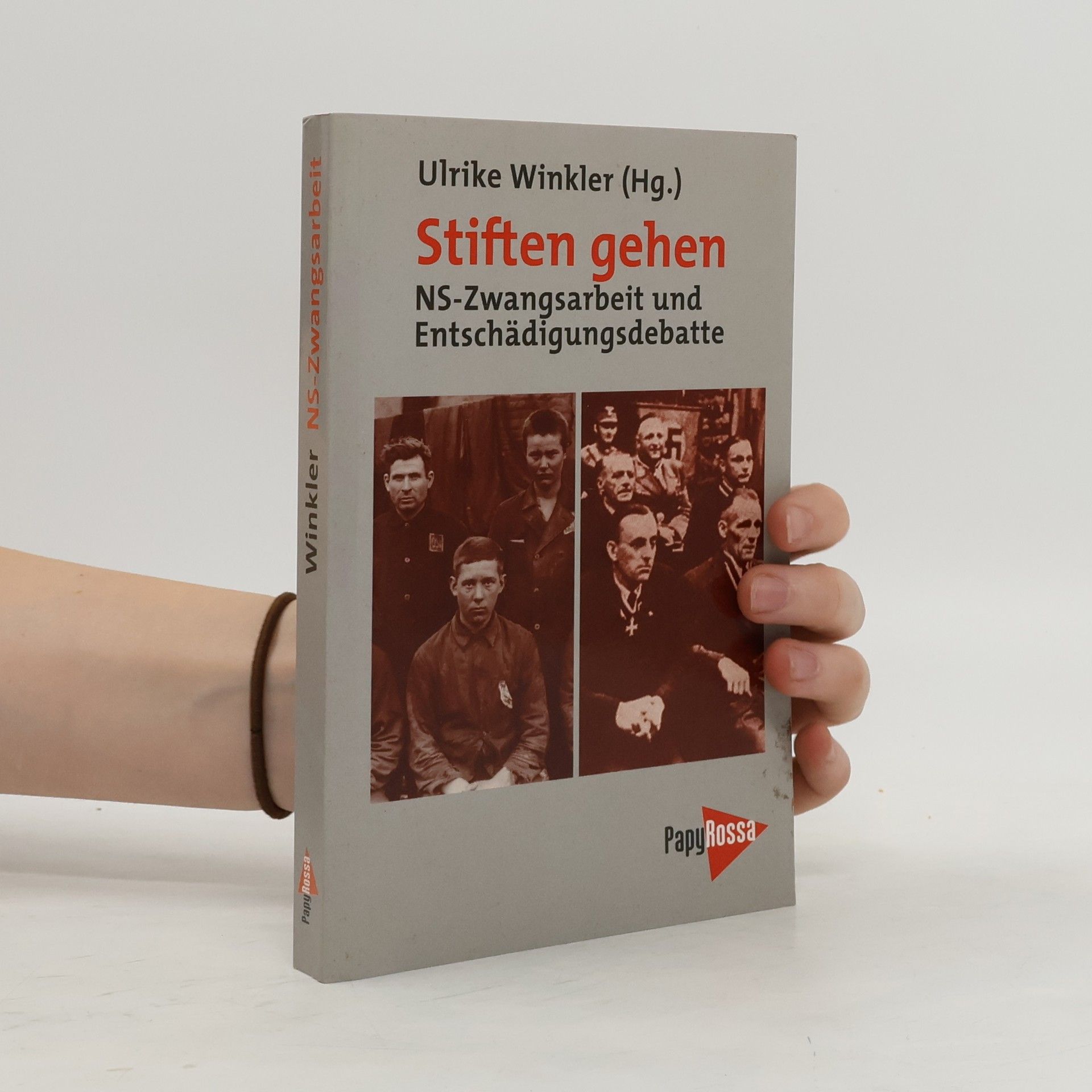


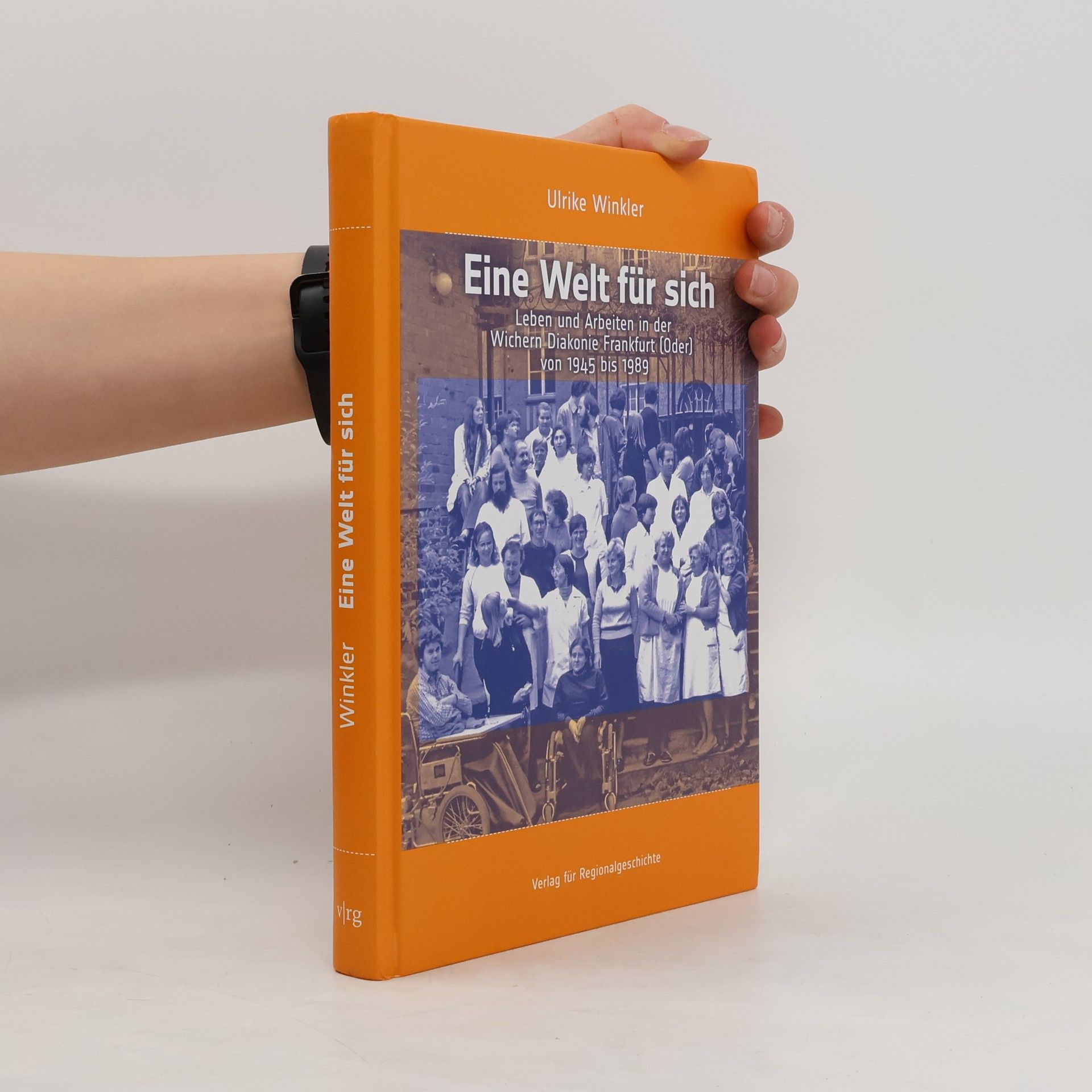
Leben und Arbeiten in der Wichern Diakonie Frankfurt (Oder) von 1945 bis 1989
Der Margaretenhort in Hamburg-Harburg in den 1970er und 1980er Jahren
Im Margaretenhort in Hamburg-Harburg erlitten Mädchen und Jungen in den 1970er und 1980er Jahren teils massive Gewalt. Männliche Bewohner und Jugendliche von außerhalb beschimpften, schlugen, nötigten und vergewaltigten sie. Wie konnte dies in einem christlichen Heim geschehen? Wieso wurde den Betroffenen nicht geglaubt, als sie ihren Erzieherinnen von diesen Vorfällen berichteten? Welche Faktoren und Strukturen ließen eine Kultur des Wegschauens und des Verschweigens entstehen und sich verfestigen? Wer trug dafür die Verantwortung? Mit Hilfe von Zeitzeug*innen und einschlägiger Quellenbestände wird diesen und anderen Fragen nachgegangen. Die Antworten sind ebenso bedrückend, wie sie auf die Notwendigkeit von Schutz- und Präventionskonzepten verweisen.
Menschen mit Behinderungen in der DDR: Lebensbedingungen und materielle Barrieren
Menschen mit Behinderungen spielen in der Forschung zur Sozialgeschichte der DDR bislang kaum eine Rolle. Dabei gewährt die Einnahme ihrer spezifischen Perspektive neue und luzide Einblicke in ein System von „komplexer Rehabilitation“, staatlichem Paternalismus und Selbstermächtigung. Am Beispiel der architektonischen Gegebenheiten der „alten Stadt“ Halle (Saale) und der „sozialistischen Stadt“ Halle-Neustadt wird erstmals der Frage nach barrierefreiem Bauen in der DDR und einer entsprechenden Gestaltung privater und öffentlicher Räume aus der Perspektive von Menschen mit Behinderungen und von staatlichen Stellen nachgegangen. Dafür hat die Autorin u. a. mit Betroffenen, Angehörigen oder auch damaligen Architekten gesprochen.