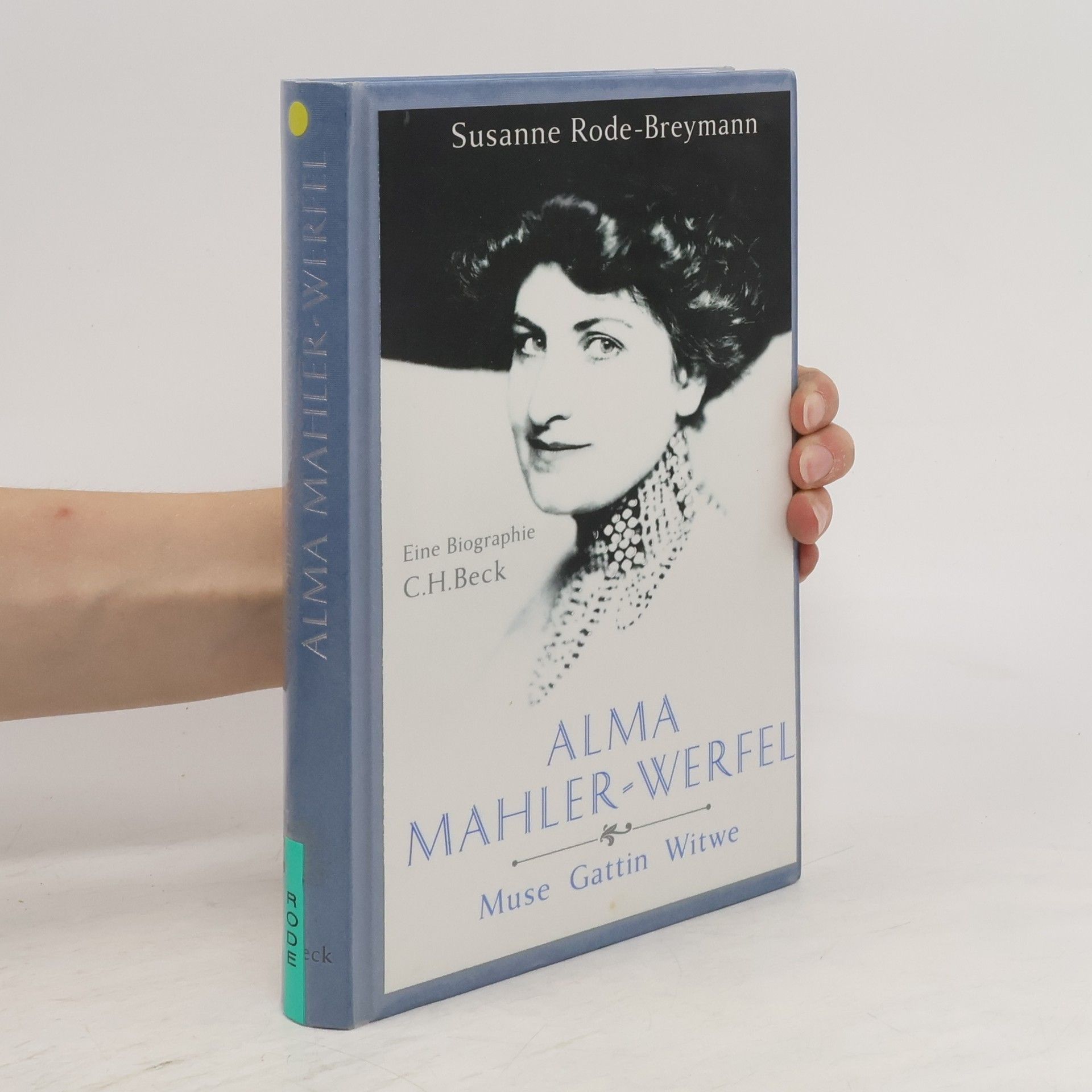Frauen erfinden, verbreiten, sammeln, bewerten Musik
Werkstattberichte aus dem Forschungszentrum Musik und Gender
- 309pages
- 11 heures de lecture
Der dritte Band der Beiträge aus dem Forschungszentrum Musik und Gender gibt Einblick in die Denkwerkstatt von Lehrenden, Promovierenden, Studierenden und Bibliothekarinnen, die seit 2006 im fmg forschen, lehren, sammeln, publizieren. Gemeinsam haben sie das fmg zu einem lebendigen Vernetzungszentrum mit großer Ausstrahlung gemacht. In den fünf Kapiteln »I. Geschlechterrollen«, »II. Musik erfinden: Komponierende Frauen«, »III. Musik verbreiten und vermitteln: Musikkulturell handelnde Frauen«, »IV. Musik sammeln und archivieren«, »V. Musik bewerten: Historiographie und Ästhetik« gibt der Band Response auf die Möglichkeiten, die das fmg bietet und versammelt Beiträge, die »nie entstanden wären, wenn es das fmg nicht gäbe«. Sie durchmessen die Zeit (vom Forschen über Shakespeares Ariel bis zum Interview mit Sofia Gubaidulina), den Ort (von England bis Russland und von Norwegen bis Venedig) und das musikbezogene Handeln von Frauen und Männern (von der Komponistin bis zur Druckerin).