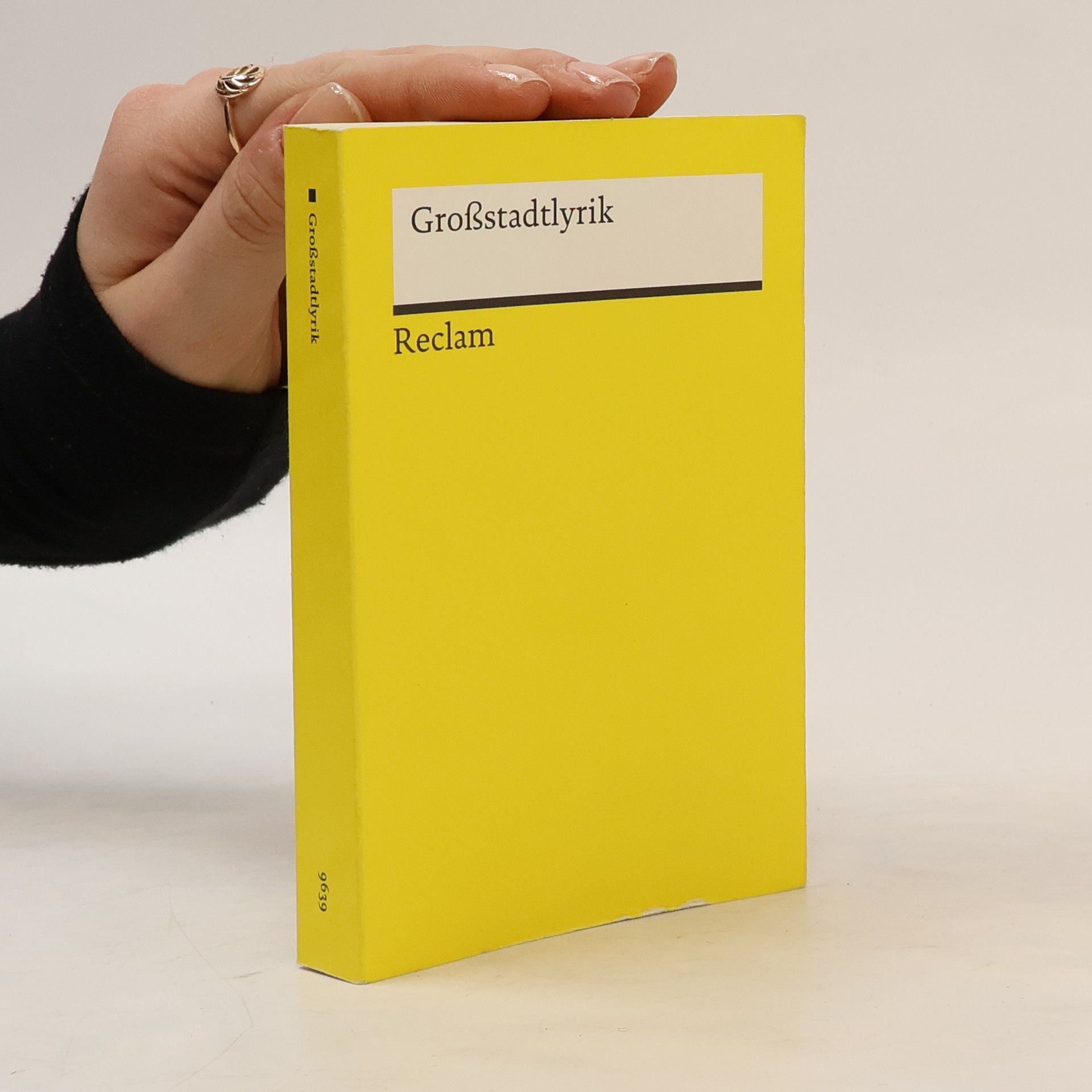Großstadtlyrik
- 412pages
- 15 heures de lecture
Großstädte sind die Experimentierfelder der Moderne. Sie stehen für die Befreiung aus provinzieller Enge und Orientierungslosigkeit, für Erlebnisreichtum und Isolation, für Komsumparadies und Elend, für technischen Fortschritt und ökologische Fehlentwicklungen. Vom Naturalismus bis in die Gegenwart haben Lyriker die Entwicklung dieses Phänomens in ihren Gedichten festgehalten. Diese Sammlung präsentiert Großstadtlyrik in ihrer ganzen thematischen und stilistischen Vielfalt.