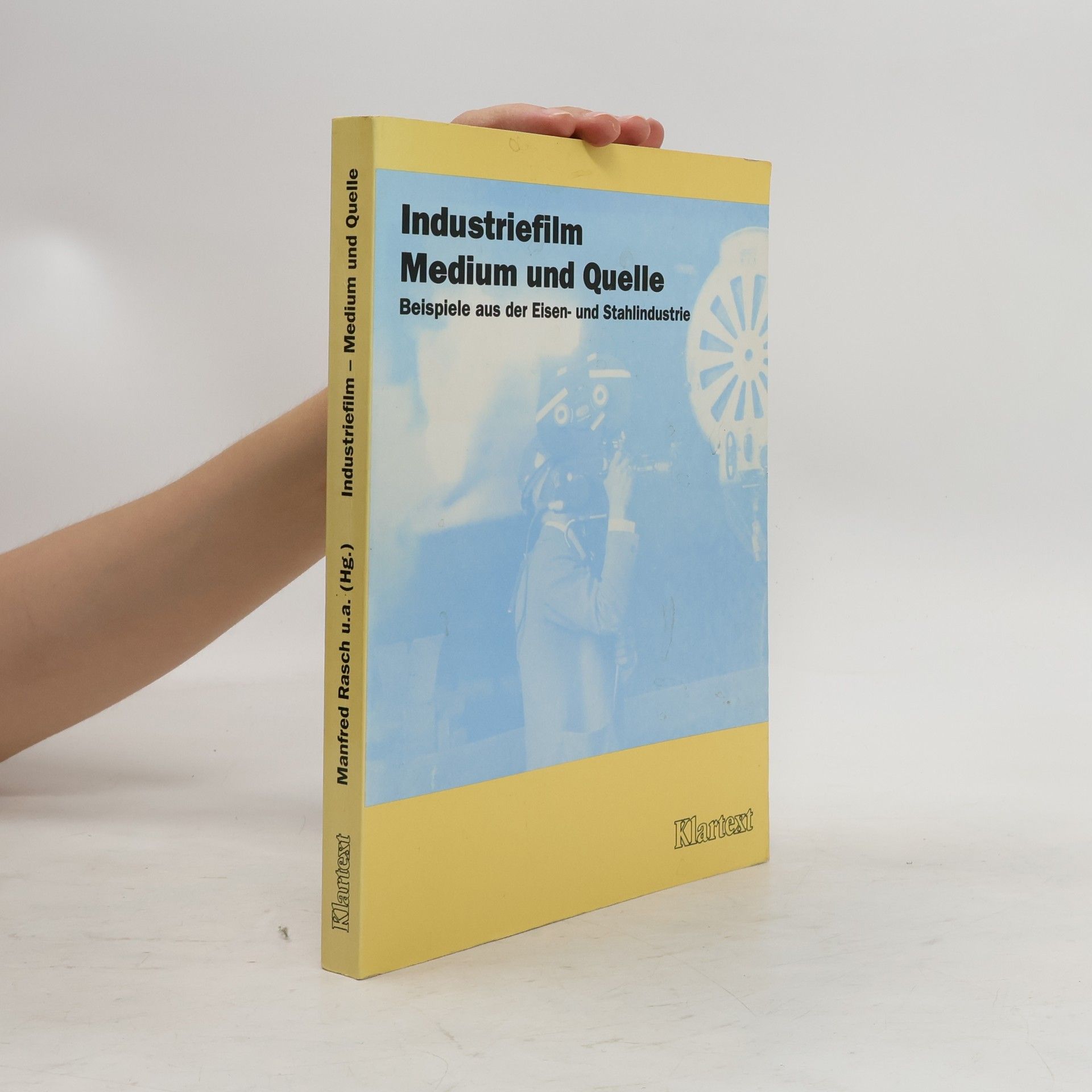Das Ruhrgebiet im Ersten Weltkrieg
Technik und Wirtschaft
Das Buch beleuchtet die Rolle des Ruhrgebiets im Ersten Weltkrieg, wo neben Krupp auch andere Unternehmen Waffen und Munition produzierten. In 24 Kapiteln werden Maßnahmen, Rüstungsproduktion, technische Herausforderungen und Kriegsgewinne detailliert dargestellt, ergänzt durch zahlreiche Abbildungen.