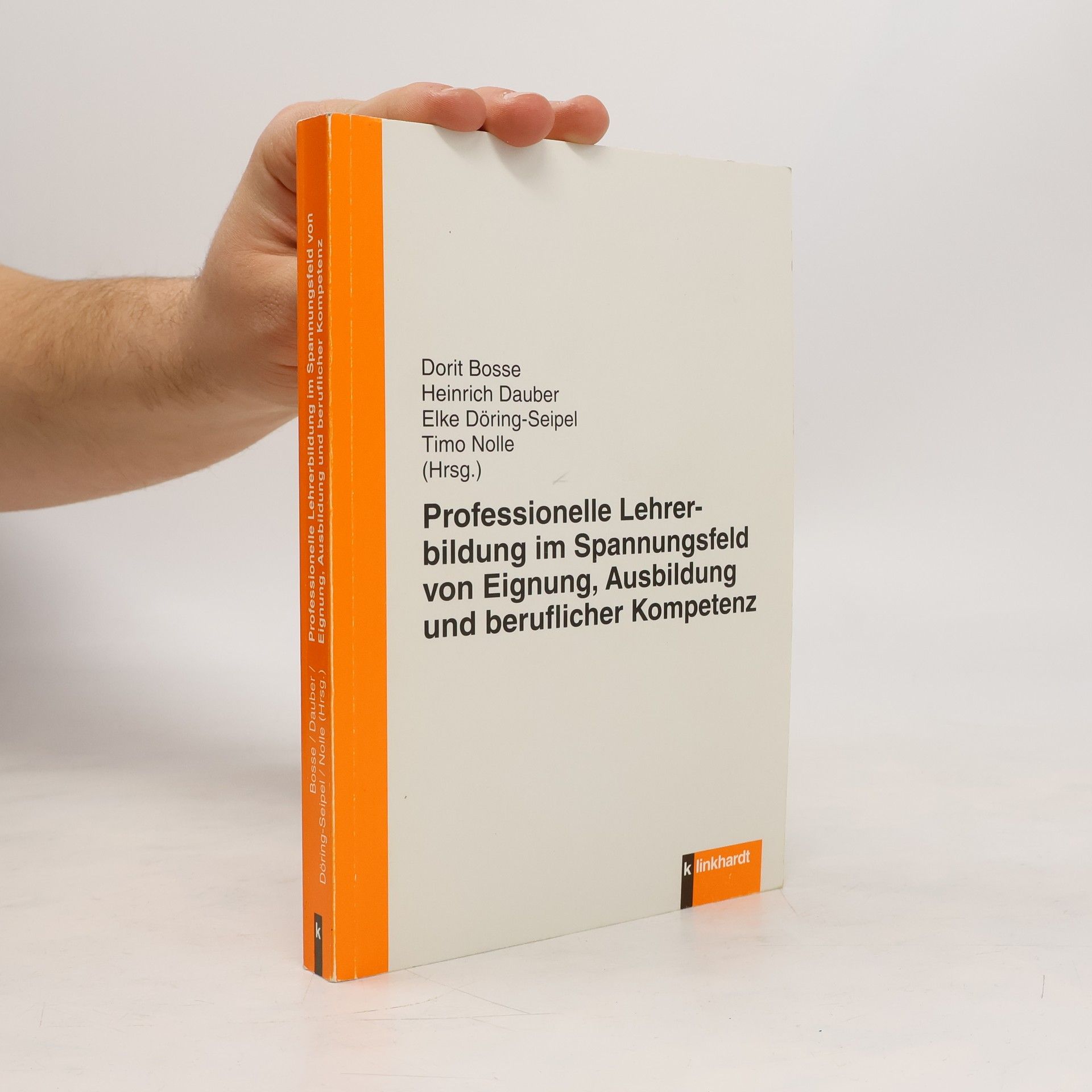Professionelle Lehrerbildung im Spannungsfeld von Eignung, Ausbildung und beruflicher Kompetenz
- 256pages
- 9 heures de lecture
Über die Frage, wie Lehramtsstudierende für ihre zukünftige Berufstätigkeit gut ausgebildet werden können, ist im Zusammenhang mit kompetenz-orientierter Lehrerbildung in den vergangenen Jahren viel diskutiert worden. Aber sind es auch die richtigen Studierenden, die sich für den Lehrerberuf entscheiden? Die Eignungsfrage ist angesichts der gestiegenen beruflichen Anforderungen im Arbeitsfeld Schule virulent geworden, aber auch aufgrund der Forschungsbefunde zu Lehrerbelastung und Lehrergesundheit. Diese Diskussionsstränge werden im Band aufgegriffen, besonders mit Blick auf den aktuellen Trend von der Eignungsreflexion zur Potenzialentwicklung in Praxis und Forschung. Dabei wird deutlich, dass in beiden Ausbildungsphasen im Zuge der Qualitätsverbesserung einer professionellen Lehrerbildung die Person des Lehrers wieder an Bedeutung gewinnt. Mit Beiträgen von: Peter Berger / Frauke-Jantje Bos / Olaf-Axel Burow / Helmut Heyse / Monika Justus / Josef Keuffer / Reiner Lehberger / Johannes Mayr / Birgit Nieskens / Jörg Schlömerkemper / Bernhard Sieland / Birgit Weyand