Die Ausbildung zum Psychoanalytiker ist ein lebenslanger Prozess, in dem jeder Therapeut sein eigenes Arbeitsmodell entwickelt. Dieses Modell besteht aus Haltungen und Funktionen, die teils erlernt, teils in jeder Sitzung entwickelt werden müssen. Der Autor beschreibt erforderliche Qualitäten und entwirft „zehn Grundelemente einer professionellen Psychotherapie“, die Psychotherapeuten Orientierung bieten. Im Prozess des Analytiker-Werdens und -Bleibens geht es vor allem um die Entwicklung eines unverwechselbaren Erklärungsmodells, das aus der Dynamik von Gelingen und Scheitern entsteht. Der Autor zeigt detailliert, welche Haltungen und Funktionen des Analytikers für diesen ständigen Umwandlungsprozess notwendig sind, und untersucht diese im Kontext von Achtsamkeit, Wunsch- und Traumdynamik, Beziehungsgefühl und Deutungen. Die zentrale These besagt, dass Präsenz, Gegenübertragung und Einsicht als essentielle qualitative Elemente psychoanalytischen und psychotherapeutischen Handelns zu betrachten sind und somit für eine professionelle Praxis unverzichtbar sind. Der Autor diskutiert, ob diese Erkenntnisse aus der psychoanalytischen Arbeit auf die professionelle Psychotherapie generalisiert werden können und formuliert Hypothesen für die „Zehn Grundelemente professioneller Psychotherapie“. Das Buch richtet sich an Psychoanalytiker und psychodynamisch orientierte Therapeuten sowie an Teilnehmer der Aus- und Weiterbildung.
Ralf Zwiebel Livres




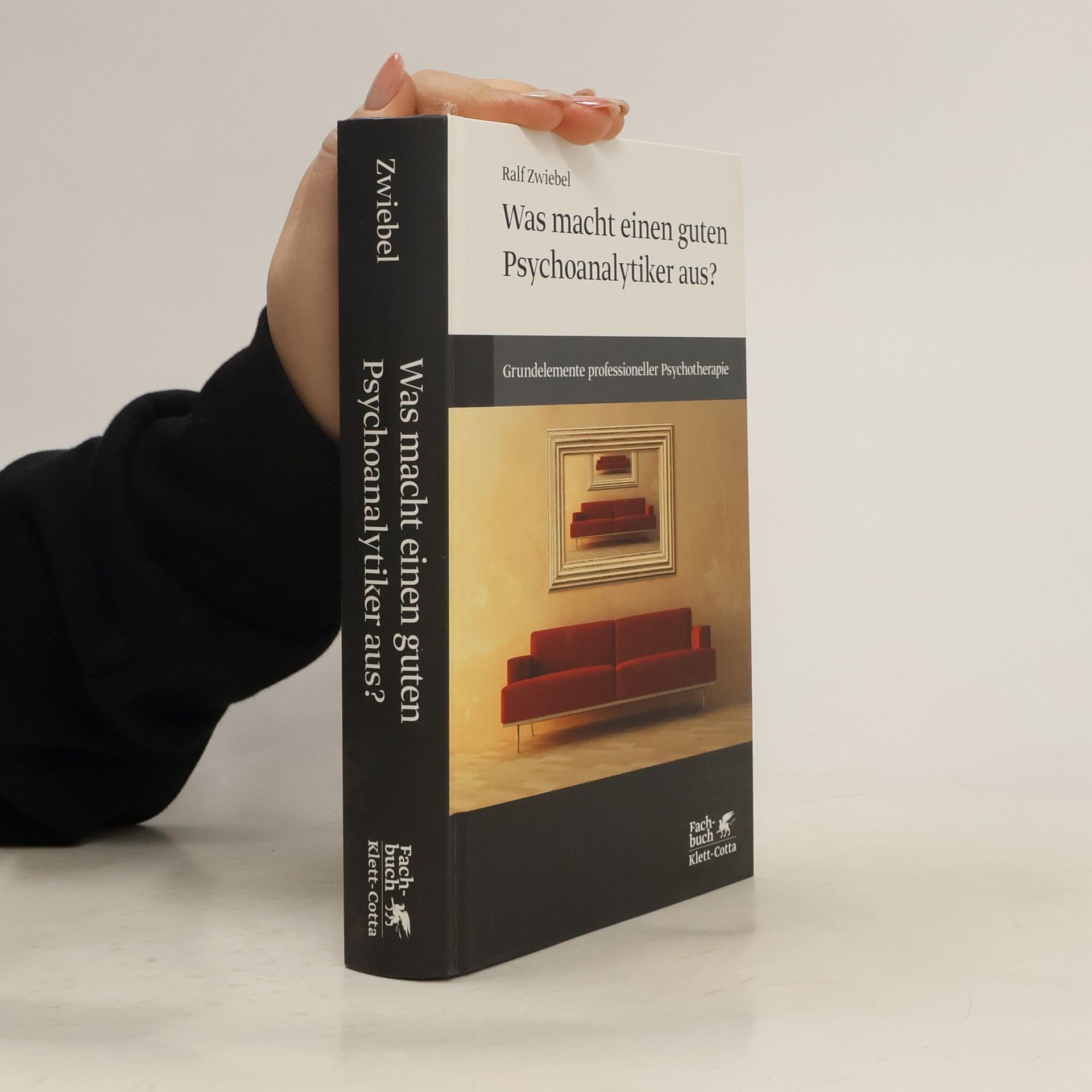
Daseinsanalyse, Psychoanalyse und Buddhismus im Gespräch
Reflexionen über Anfang und Ende
Wie blicken Daseinsanalyse, Psychoanalyse und Buddhismus auf die Welt, wie auf Fragen des Lebens und Sterbens? Welche Lebens- und Selbstmodelle ergeben sich aus diesen verschiedenen Anschauungen? Ausgehend von Alice Holzhey-Kunz’ daseinsanalytischem Ansatz, der die psychoanalytische Theorie Sigmund Freuds mit existenzphilosophischen Auffassungen verbindet, treten der Psychoanalytiker Ralf Zwiebel und der Zen-Meister Gerald Weischede in einen intensiven Dialog, in dem die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der drei Traditionen sichtbar werden. Mit ihren Reflexionen bieten die Autoren zunächst eine knappe Einführung in Psychoanalyse, Buddhismus und Daseinsanalyse, um anschließend vertiefend auf Fragen der Existenzphilosophie, der klinischen Psychoanalyse und Erfahrungen aus der eigenen meditativen Praxis einzugehen.
In der Arbeit mit den Patienten ist die Müdigkeitsreaktion von Analytikern nicht selten, wenn auch in der Regel unerwünscht. Gleichzeitig ist sie ein zentraler Indikator für die Qualität der analytisch-therapeutischen Beziehung. Der Autor macht Vorschläge, wie sie bearbeitet und bewältigt werden kann. Die Müdigkeit des Analytikers ist eine unvermeidliche, wenn auch in der Regel unerwünschte Reaktion in der analytischen Situation. Richtig verstanden kann ihm dieses Phänomen wertvolle diagnostische und behandlungstechnische Hinweise liefern. Ausgehend von der inneren Arbeitsweise des Analytikers fasst Zwiebel die Müdigkeit als symptomatische Reaktion im Sinne einer »Störung« des abwartenden Zuhörens auf: Patient, Analytiker und die besondere Struktur der analytisch-therapeutischen Situation tragen zur Entwicklung dieses Phänomens bei. Er diskutiert die »Dynamik von Anwesenheit und Abwesenheit« und zeigt, wie der Analytiker Müdigkeit durcharbeiten und bewältigen kann. Zielgruppe: - PsychoanalytikerInnen - Therapeuten aller Richtungen, denen das Phänomen Müdigkeit nicht unbekannt ist »Ein sehr reiches, zeitloses Buch - sehr emofehlenswert!« Dunja Voos, Medizin im Test, 28.04.2019
Buddha und Freud - Präsenz und Einsicht
Über buddhistisches und psychoanalytisches Denken
- 278pages
- 10 heures de lecture
Trotz der vorherrschenden Einschätzung, dass Buddhismus und Psychoanalyse eher konträre Strömungen mit ganz unterschiedlicher Weltauffassung seien, stellen sie doch beide das menschliche Leiden und Wege der Überwindung in ihren Fokus. Beide Ansätze zeigen bei genauer Betrachtung wesentliche Gemeinsamkeiten. Der Psychoanalytiker Ralf Zwiebel und der Zen-Meister Gerald Weischede treten in einen integrierenden Dialog |ber ihre individuellen Arbeitsmodelle, die als grundlegende Annahmen von Selbst und Welt verstanden werden. Sie fragen detailliert nach den wechselseitig befruchtenden Lernmöglichkeiten beider Systeme. Ihr Fazit ist, dass die Psychoanalyse sehr von der Praxis der im Buddhismus kultivierten Präsenz, der Buddhismus sehr von der Praxis der lebensgeschichtlich geprägten Reflexion der Psychoanalyse profitieren kann.
Von der Angst, Psychoanalytiker zu sein
Das Durcharbeiten der phobischen Position
- 226pages
- 8 heures de lecture