Lessings Klassiker, 1772 uraufgeführt, ist heute so lebendig wie eh und je und von den Theaterbühnen nicht mehr wegzudenken: Die Heldin wird von ihrem Vater erdolcht, der sie vor dem Prinzen, vor Unmoral und Laster bewahren will. Zeilenkommentar, Quellen und Texte zur Rezeption erleichtern in bewährter Form das Verständnis des Werks.
Gesa Dane Livres
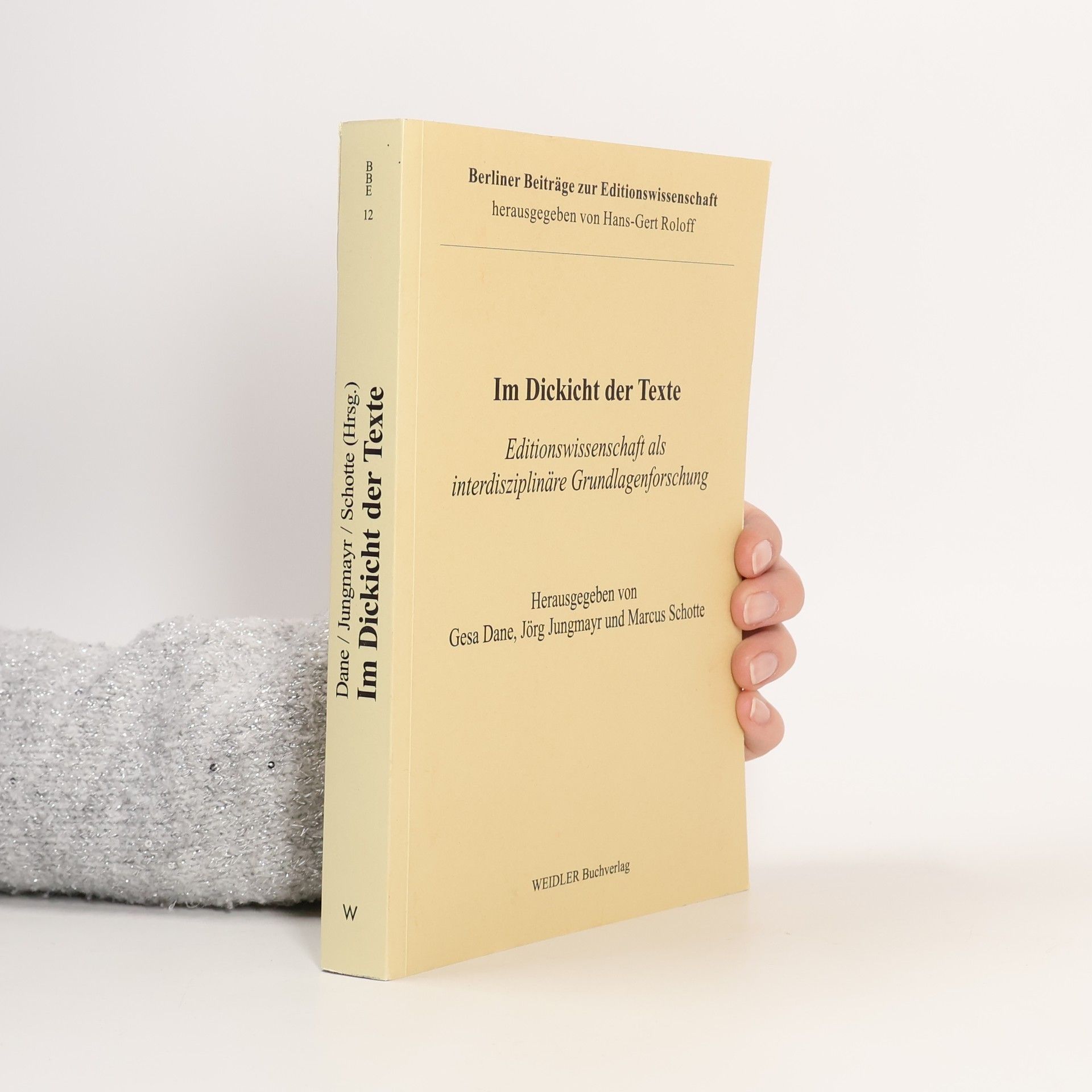
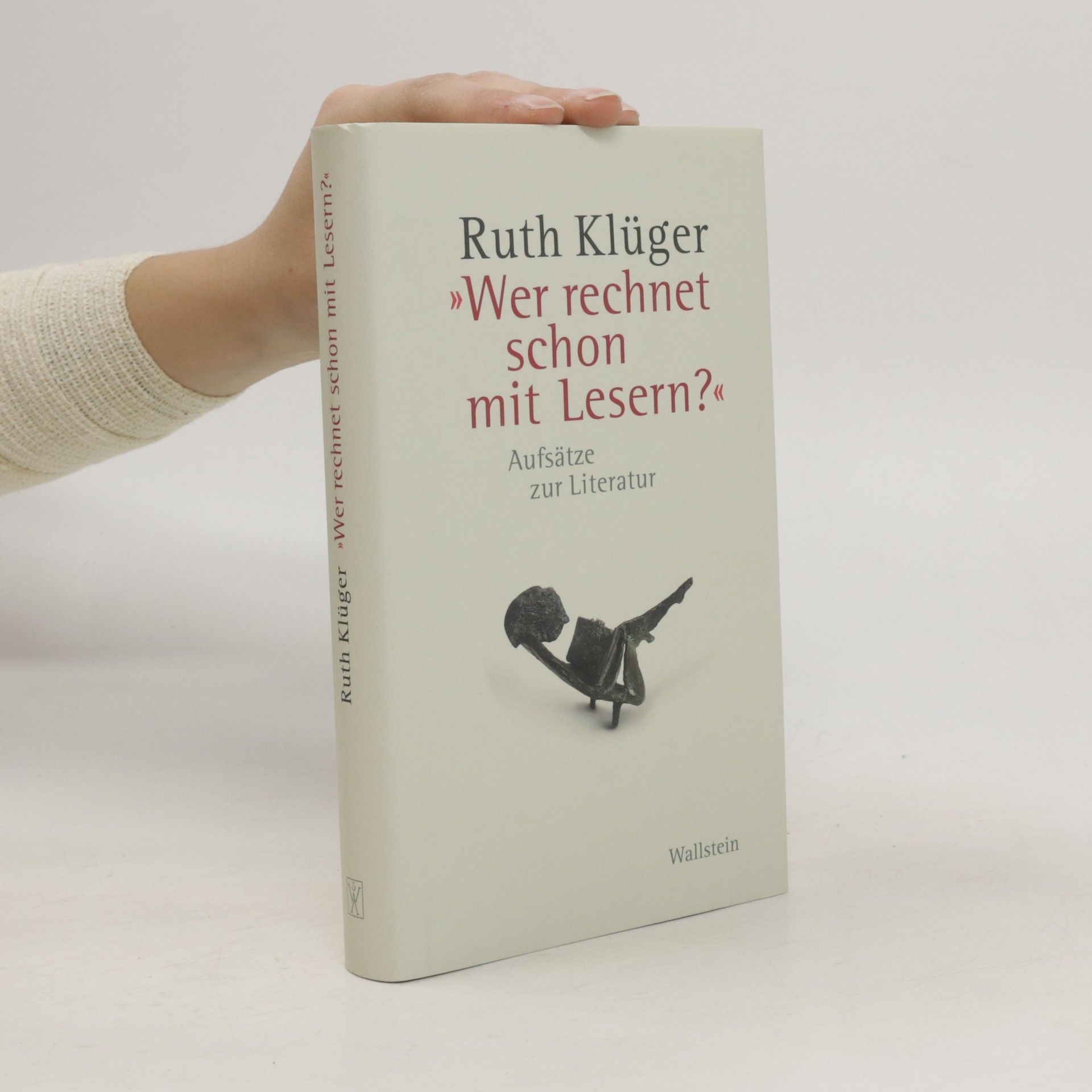


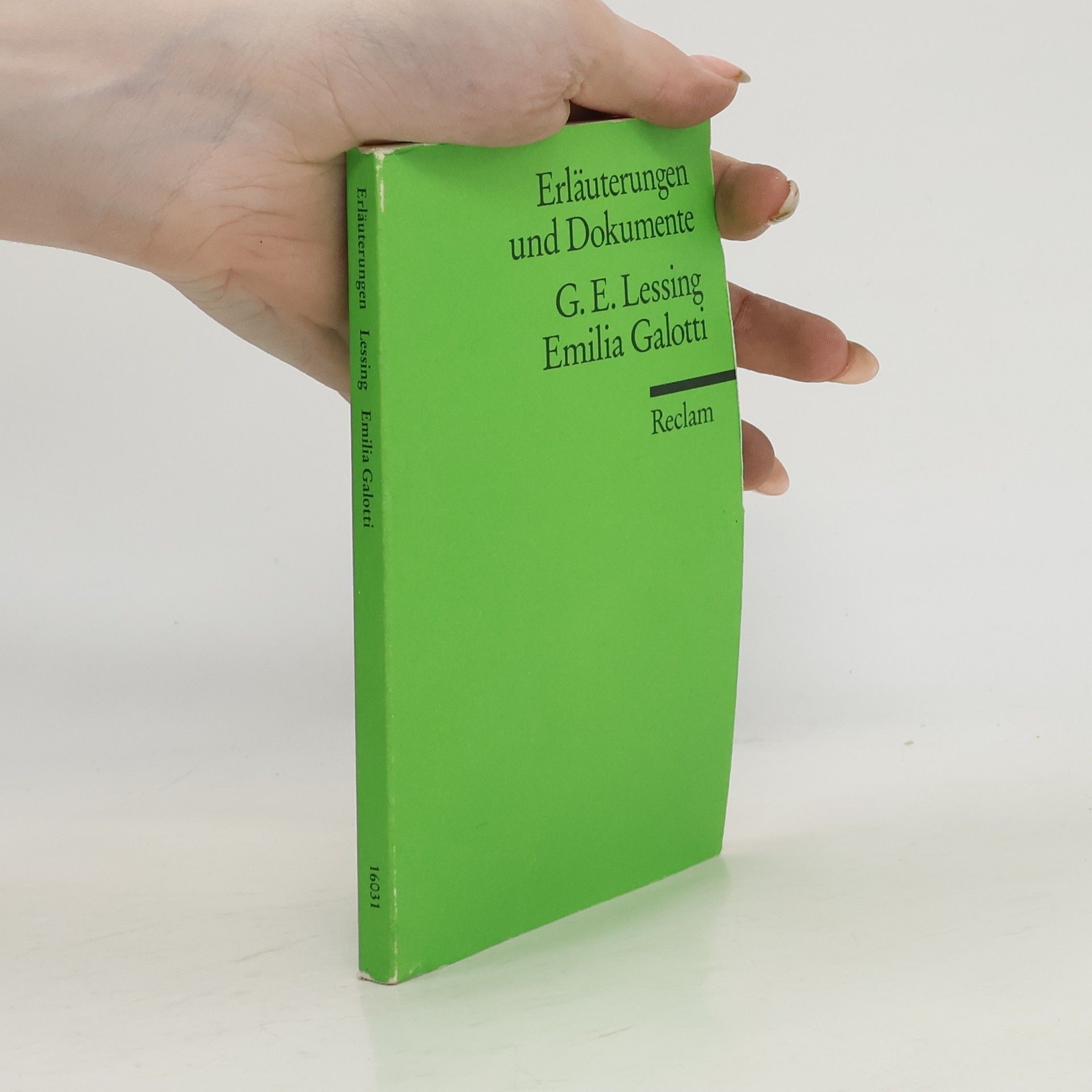
»Ich kann eigentlich nichts als lesen und schreiben.«
Zum literarischen und literaturwissenschaftlichen Werk von Ruth Klüger
Literaturwissenschaftliche Annäherungen an das facettenreiche Werk der Autorin von »weiter leben«. Durch ihr 1992 erschienenes Buch »weiter leben. Eine Jugend« ist Ruth Klüger (1931-2020) weit über ihr Fach, die Germanistik, hinaus bekannt geworden. Auch ihr literaturwissenschaftliches und dichterisches Werk findet in jüngster Zeit verstärkte Beachtung. Die in diesem Band versammelten Aufsätze europäischer und amerikanischer Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler nehmen das Gesamtwerk Klügers in den Blick und decken unerwartete Querverbindungen zwischen den verschiedenen Gattungen ihres Schreibens auf. Dabei kommen ihre innovatorischen Beiträge zu den Jewish Studies und zu einer feministischen Literaturwissenschaft ebenso zur Sprache wie ihre wissenschaftlich bedeutsame Dissertation zum barocken Epigramm. Nicht zuletzt werden ihre frühen Versuche, sich als amerikanische Autorin zu etablieren, rekonstruiert und durch ein Werkverzeichnis erschlossen. Die Beiträge dieses Bandes werden entsprechend der von Ruth Klüger selbst praktizierten Zweisprachigkeit jeweils in ihrer Originalsprache in Deutsch und Englisch gedruckt. Mit Beiträgen von: Sigrid Bauschinger, Gesa Dane, Heinrich Detering, Kai Evers, Konstanze Fliedl, Mark H. Gelber, Barbara Hahn, Gail K. Hart, Irène Heidelberger-Leonard, Irene Kacandes, Meredith Lee, Peter C. Pfeiffer, Daniela Strigl und Thedel v. Wallmoden
"Zeter und Mordio"
Vergewaltigung in Literatur und Recht
Eine prominente Reihe literarischer Vergewaltigungsfälle seit dem 17. Jahrhundert wird aus dem Horizont der Rechts- und Kulturgeschichte literaturgeschichtlich analysiert. Vergewaltigung gilt, wie Raub, Mord und Totschlag, seit alters als schweres Verbrechen. Welcher erzwungene Beischlaf allerdings jeweils als Verbrechen zu qualifizieren war und unter welchen Bedingungen diese Tat sanktio-niert werden konnte, erschließt sich erst im Zusammenhang mit den Rechtsnormen einer Zeit. Die Untersuchung von Gesa Dane rekonstruiert die Strafrechtsgeschichte dieses Verbrechens, um vor deren Hintergrund literarische Texte vom 17. bis zum 20. Jahrhundert zu deuten. Zwar werden Vergewaltigungen hier aus Dezenzgründen bis weit in das 20. Jahrhundert nicht direkt geschildert, doch gelingt der Verfasserin mithilfe einer umsichtigen kulturhistorischen Spurensuche der Nachweis, daß die Texte selber es nie im Ungewissen lassen, ob es sich nach zeitgenössischen Vorstellungen um erzwungenen Beischlaf oder um Verführung handelt. In dieser Hinsicht werden Texte u. a. von Harsdörffer, Grimmelshausen, Lohenstein, Calderón, Richardson, Lessing, Goethe, Kleist, Hardy, Hahn-Hahn bis hin zu Parei und Duwe neu gedeutet und zum Sprechen gebracht.
Ruth Klüger war eine der bedeutendsten Germanistinnen ihrer Generation. Ihr umfangreiches wissenschaftliches Werk umspannt die deutschsprachige Literatur von Mittelalter und Renaissance bis zur Gegenwart, mit Ausblicken auf amerikanische, englische und französische Traditionen. In den 1970er-Jahren gab sie in der amerikanischen Germanistik entscheidende Anstöße zur Entwicklung der feministischen Literaturwissenschaft und zur Erforschung der Darstellung von Juden in der deutschen Literatur. Viele ihrer Aufsätze stehen im Zeichen dieser Doppelperspektive. Die Subtilität ihrer Deutungen kanonischer Texte (von Wolfram von Eschenbach über Lessing, Stifter, Heine, Schnitzler bis hin zu Ingeborg Bachmann) hat nichts von ihrer Anregungskraft eingebüßt. Ohne die Differenz zwischen fiktionalen und faktualen Texten zu verwischen, liest sie Literatur doch stets im Hinblick auf das soziale Verhalten von Menschen, auf Macht und ethische Normen.Der Band versammelt bislang unpublizierte oder nur entlegen veröffentlichte Aufsätze. Die englischen Beiträge wurden bewusst in der Originalsprache belassen, um die Zweisprachigkeit ihres Werks zu dokumentieren.
Berliner Beiträge zur Editionswissenschaft - 12: Im Dickicht der Texte
- 319pages
- 12 heures de lecture