Erfolgreiche Rechtsanwält:innen im Zivilprozess zeichnen sich durch das Wissen um konkrete Handlungs- und Entscheidungsalternativen aus, die sie taktisch klug einsetzen und flexibel auf unerwartete Prozessverläufe reagieren können. Das Handbuch ist auf diese praktischen Anforderungen abgestimmt und folgt dem Arbeitsablauf forensisch tätiger Anwält:innen. In der 9. Auflage werden wesentliche Neuerungen vorgestellt: Die Digitalisierung des Zivilprozesses, die bis 2026 fortschreitet, bringt bedeutende Änderungen in der Prozessorganisation für Anwälte und Gerichte. Ab 2020 gilt eine dauerhafte Wertgrenze für die Nichtzulassungsbeschwerde, die zuvor befristet war, und es gibt eine verstärkte Spezialisierung bei den Gerichten. Um pandemiebedingte Härtefälle zu vermeiden, wurde ein Vorrang- und Beschleunigungsgebot für Miet- und Pachtanpassungsverfahren eingeführt. Zudem wurde der Kontopfändungsschutz aktualisiert und die Sicherheit von Gerichtsvollziehern durch neue gesetzliche Regelungen verbessert. Die Liste der unpfändbaren Sachen wurde an die heutigen Lebensumstände angepasst, und die Pfändungsgrenzen wurden teilweise angehoben. Auch die Stärkung des prozessualen Selbstbestimmungsrechts von unter Vormundschaft stehenden Personen wird berücksichtigt, ebenso wie zahlreiche grundlegende Gerichtsentscheidungen, insbesondere des BGH.
Rainer Oberheim Livres
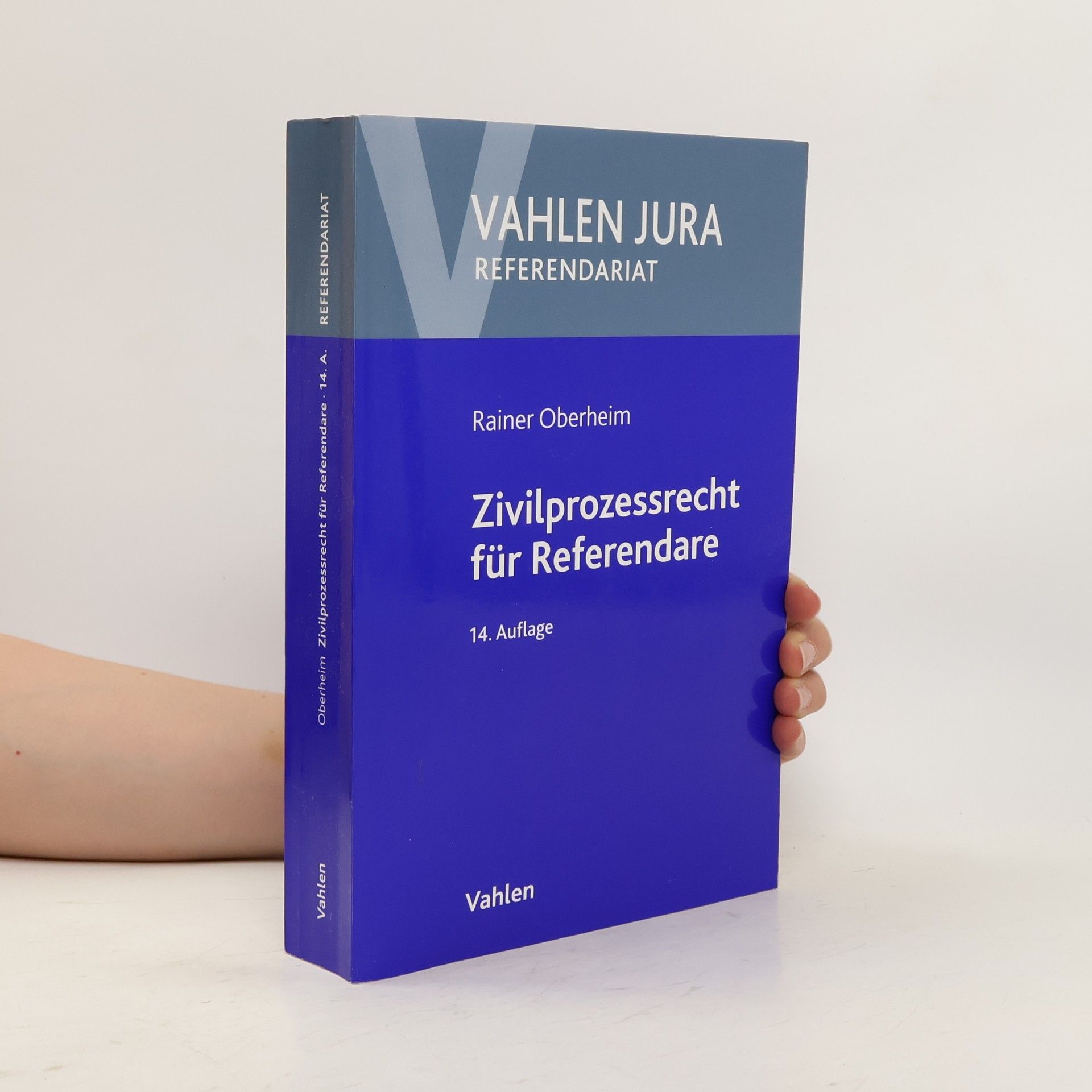

Das Zivilprozessrecht spielt eine zentrale Rolle in der Juristenausbildung, da es den Übergang vom universitären Studium zur praktischen Referendarausbildung markiert und im Assessorexamen das am stärksten vertretene Rechtsgebiet darstellt. Vertiefte Kenntnisse in diesem Bereich sind für das Gelingen der praktischen Ausbildung und die Zweite Juristische Staatsprüfung unerlässlich. Dieses Standardwerk orientiert sich an den Bedürfnissen von Referendaren und stellt zunächst die Grundbegriffe, Arbeitstechniken und Darstellungsformen vor, die für das Verständnis eines Normalprozesses erforderlich sind. In der vertiefenden Darstellung werden praxis- und examenstypische Problemkonstellationen erläutert. Zahlreiche grafische Darstellungen veranschaulichen Sachzusammenhänge und Verfahrensabläufe. Die Ausführungen basieren auf den Erfahrungen des Autors, der als Arbeitsgemeinschaftsleiter, Repetitor, Prüfer und Referatsleiter im Justizprüfungsamt tätig war. Die neu bearbeitete Auflage berücksichtigt die aktuelle Rechtsprechung und Literatur sowie die Umstellung auf e-justice und die Auswirkungen der Corona-Pandemie aus der Sicht von Richtern und Rechtsanwälten. Der Autor Dr. Rainer Oberheim war Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Frankfurt am Main.