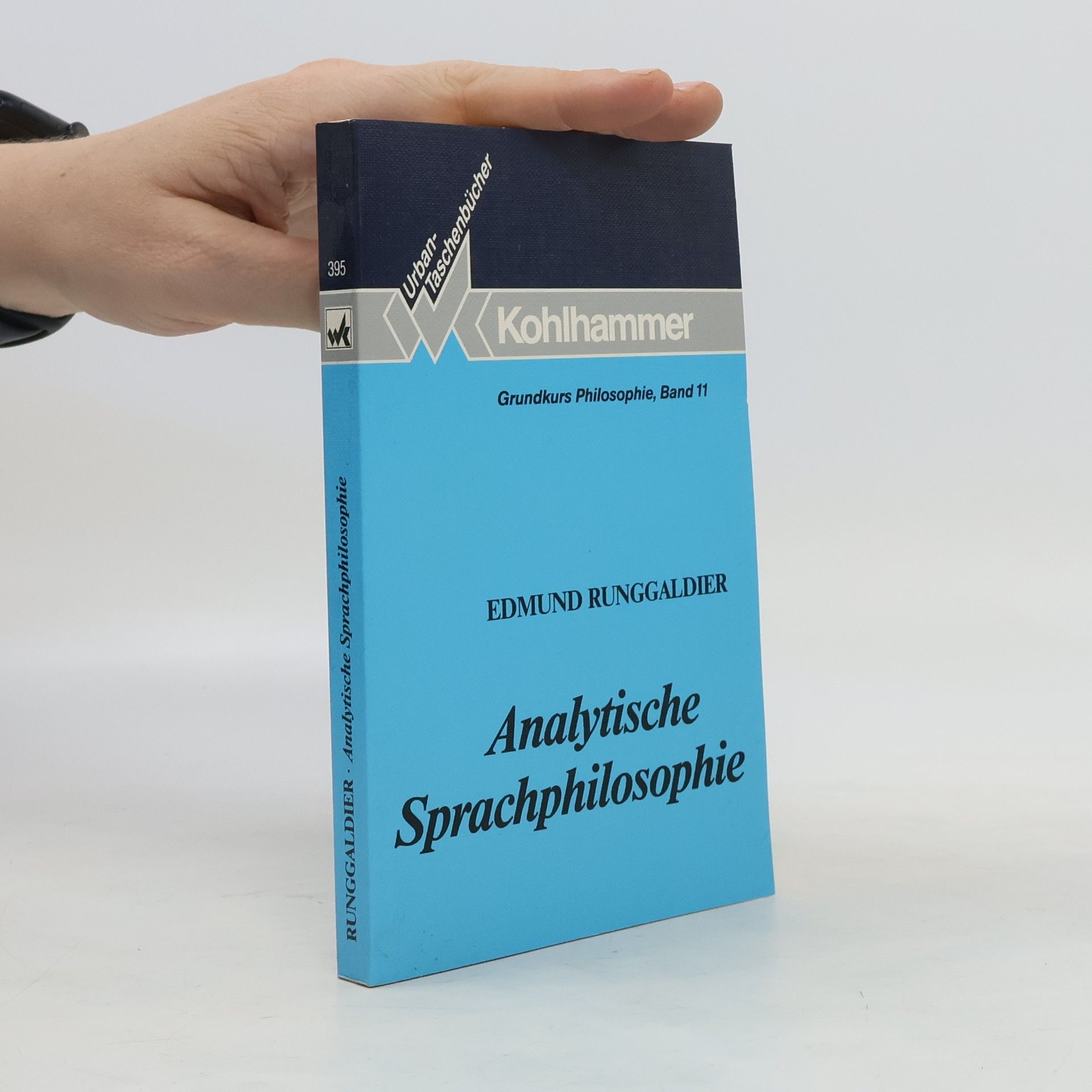God, Eternity, and Time
- 206pages
- 8 heures de lecture
The book features a diverse assembly of philosophers and theologians from America, the UK, Germany, Austria, and Switzerland, engaging in a profound exploration of God's relationship with time. Contributions include critical analyses of classical notions of eternity, such as those proposed by Boethius and Aquinas, as well as discussions on everlastingness and the implications of foreknowledge. Additionally, the text examines contemporary perspectives, including Einstein's theories, providing a comprehensive dialogue on this complex philosophical issue.