Karin Wilhelm Livres

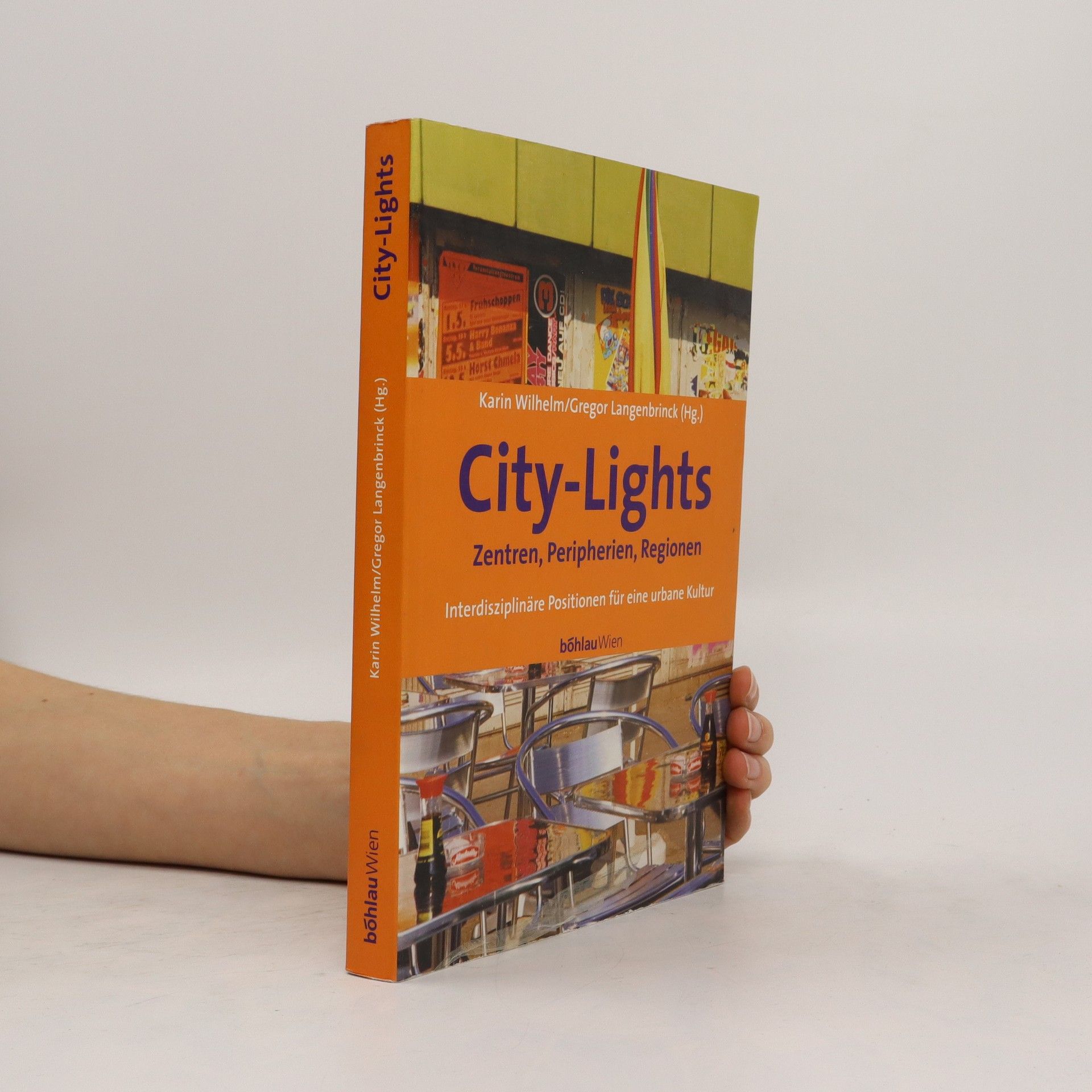
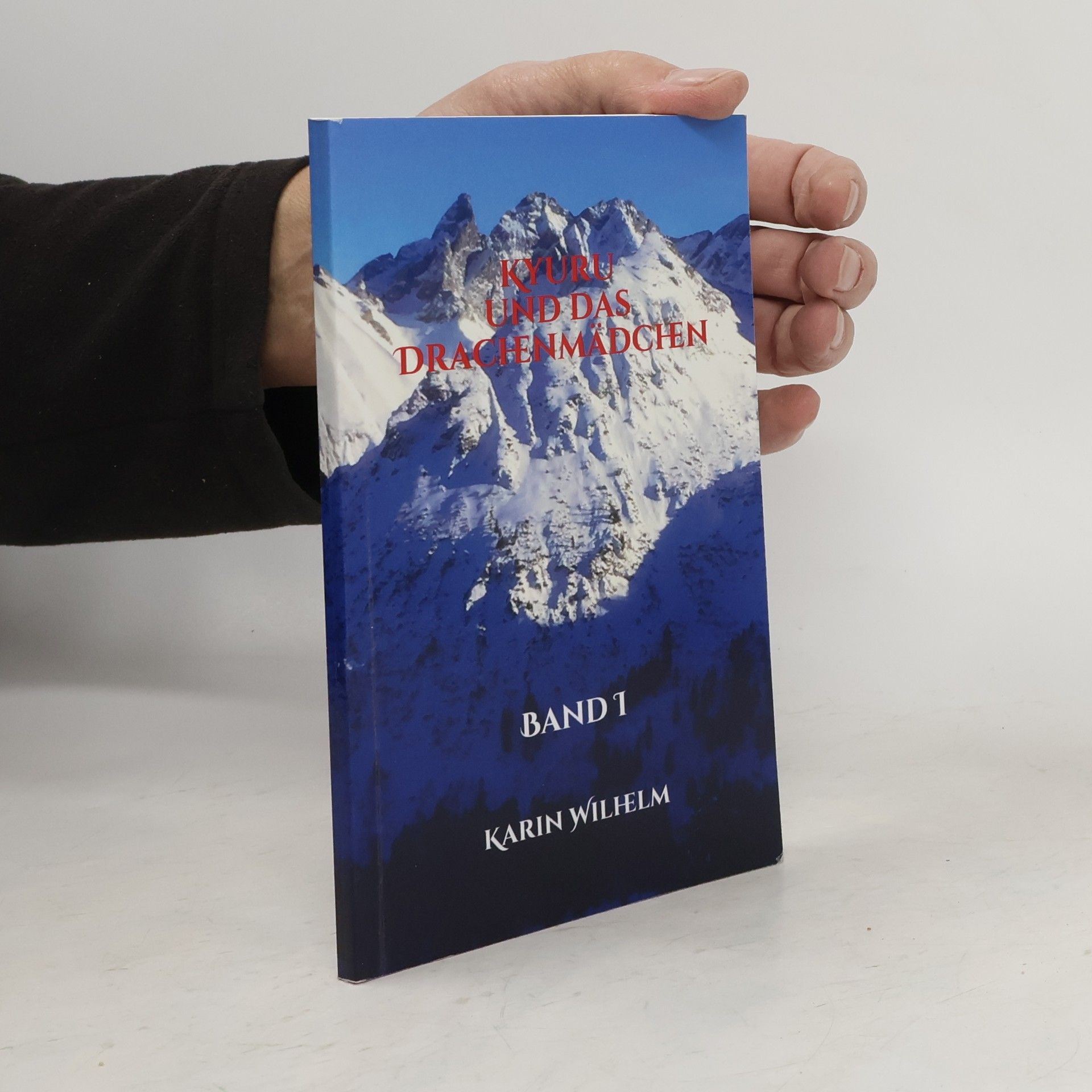
Die Städte der Welt stehen vor einer Krise. Unter dem Druck der Globalisierung entstehen in Asien und Lateinamerika riesige Megastädte, während die europäische Stadt, einst ein Symbol der demokratischen Gesellschaft, in ihrer traditionellen Form zunehmend verschwindet. Die einst strahlenden Lichter der Großstadt verschwimmen im Medienspektakel neuer Stadtzentren, die als überwachte Räume dem kommerzialisierten „urban entertainment“ dienen. Diese Entwicklung hat das klare Verhältnis zwischen Stadtzentrum und Peripherie verändert, sodass beide Bereiche sich bis zur Unkenntlichkeit durchdringen. Stadtsoziologen, Stadtplaner, Architekten und Kulturwissenschaftler liefern seit einiger Zeit unterschiedliche Analysen und Prognosen, die zwischen apokalyptischen Visionen und optimistischen Bestandsaufnahmen schwanken. Der vorliegende Aufsatzband zielt darauf ab, die derzeitige Unübersichtlichkeit zu strukturieren, indem er die methodisch unterschiedlichen Positionen der Einzelwissenschaften zusammenführt. Dadurch wird die Vernetzung der Perspektiven aus Politik, Ökonomie und Kultur dokumentiert. Allen Beiträgen gemeinsam ist die Suche nach der Widerstandsfähigkeit und Überlebenskraft der urbanen Kultur.
Paul Schneider-Esleben, Architekt
- 208pages
- 8 heures de lecture
Paul Schneider-Esleben (1915–2005) steht beispielhaft für den Aufbruch der Architektur in der frühen Bundesrepublik: Seine Innovationskraft zeigt sich in seinen Düsseldorfer Bauten wie der gläsernen Haniel-Großgarage (1950–1953), dem Mannesmann-Hochhaus (1955–1958) als erstem deutschem Nachkriegshochhaus und der Rochuskirche (1952–1955). Er hatte stets ein großes Interesse an der bildenden Kunst: Beim Bau der Rolandschule (1957–1961) etwa arbeitete er mit Günther Uecker, Heinz Mack, Otto Piene und Joseph Beuys zusammen. Mit dem Flughafen Köln-Bonn (1962–1971) gelangen ihm ein typologisch einflussreicher Entwurf sowie ein Verkehrskonzept, die beide weltweit Nachahmung fanden. Schneider-Esleben war ein vielseitiger Gestalter, der nicht nur Bürohochhäuser, Kulturzentren, Schulen, Wohnhäuser und Kirchen entwarf, sondern auch Möbel, Schmuck und seine eigene Yacht, mit der er über das Mittelmeer segelte. Der Katalog lädt ein, sein schillerndes Werk auch in aktuellen Fotografien neu zu entdecken.