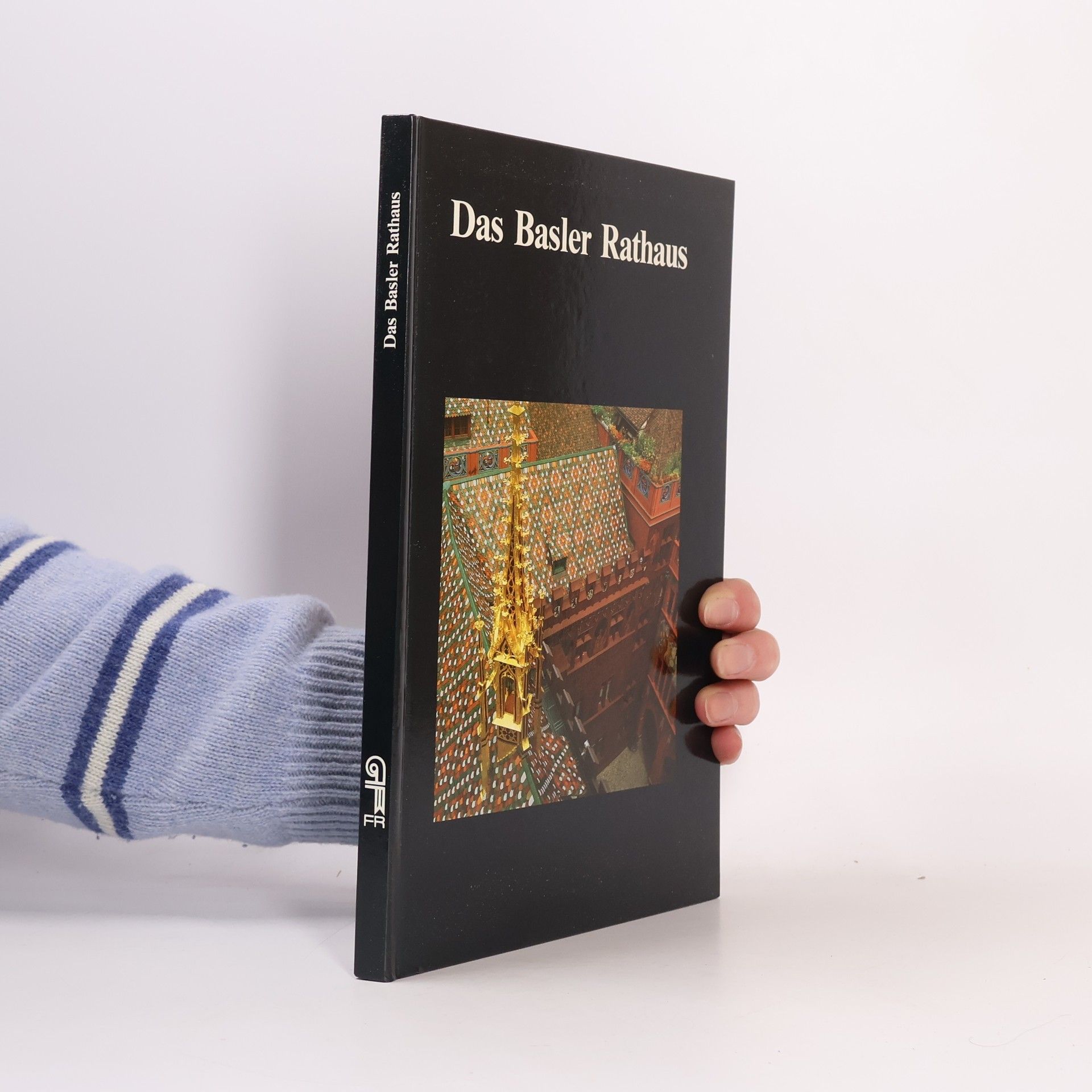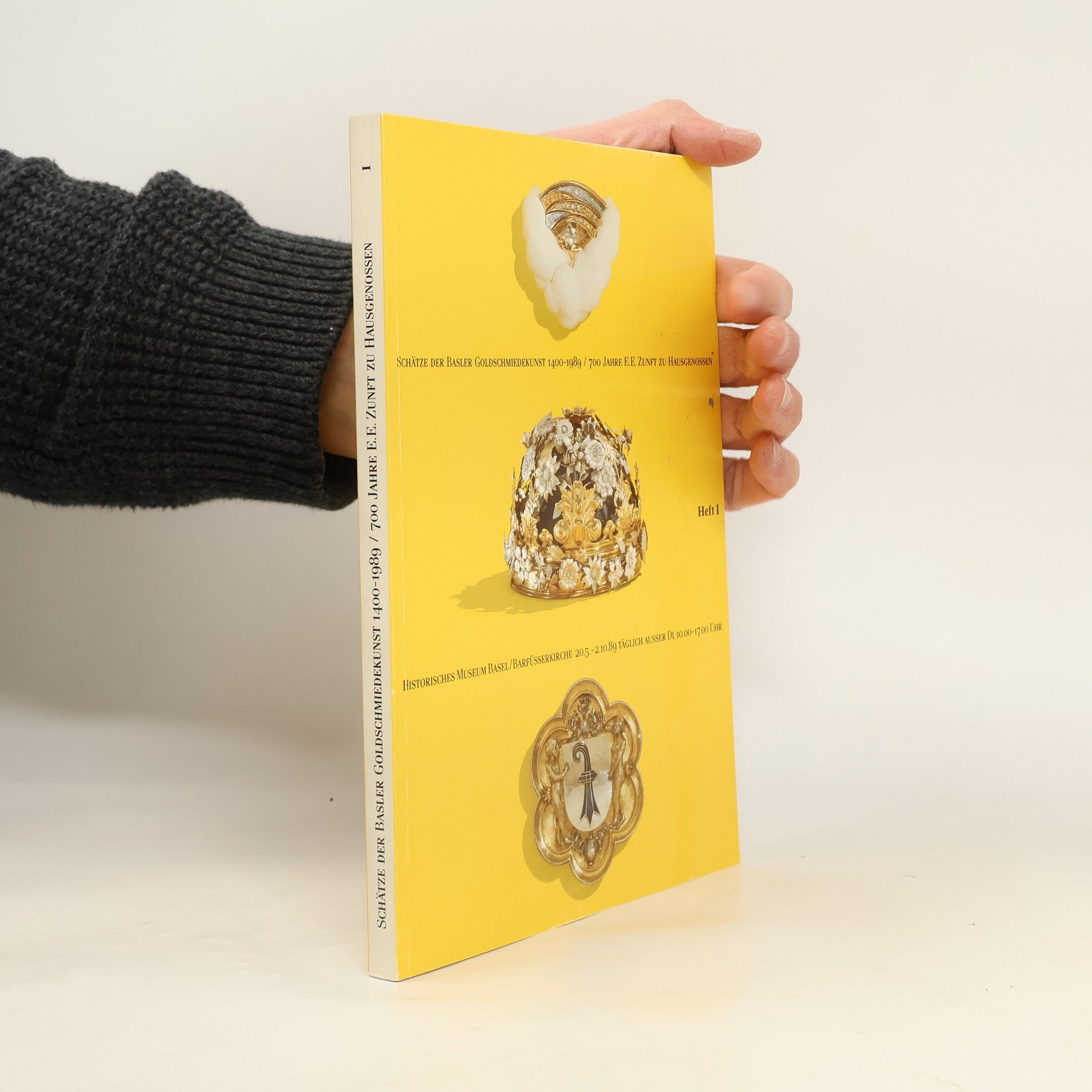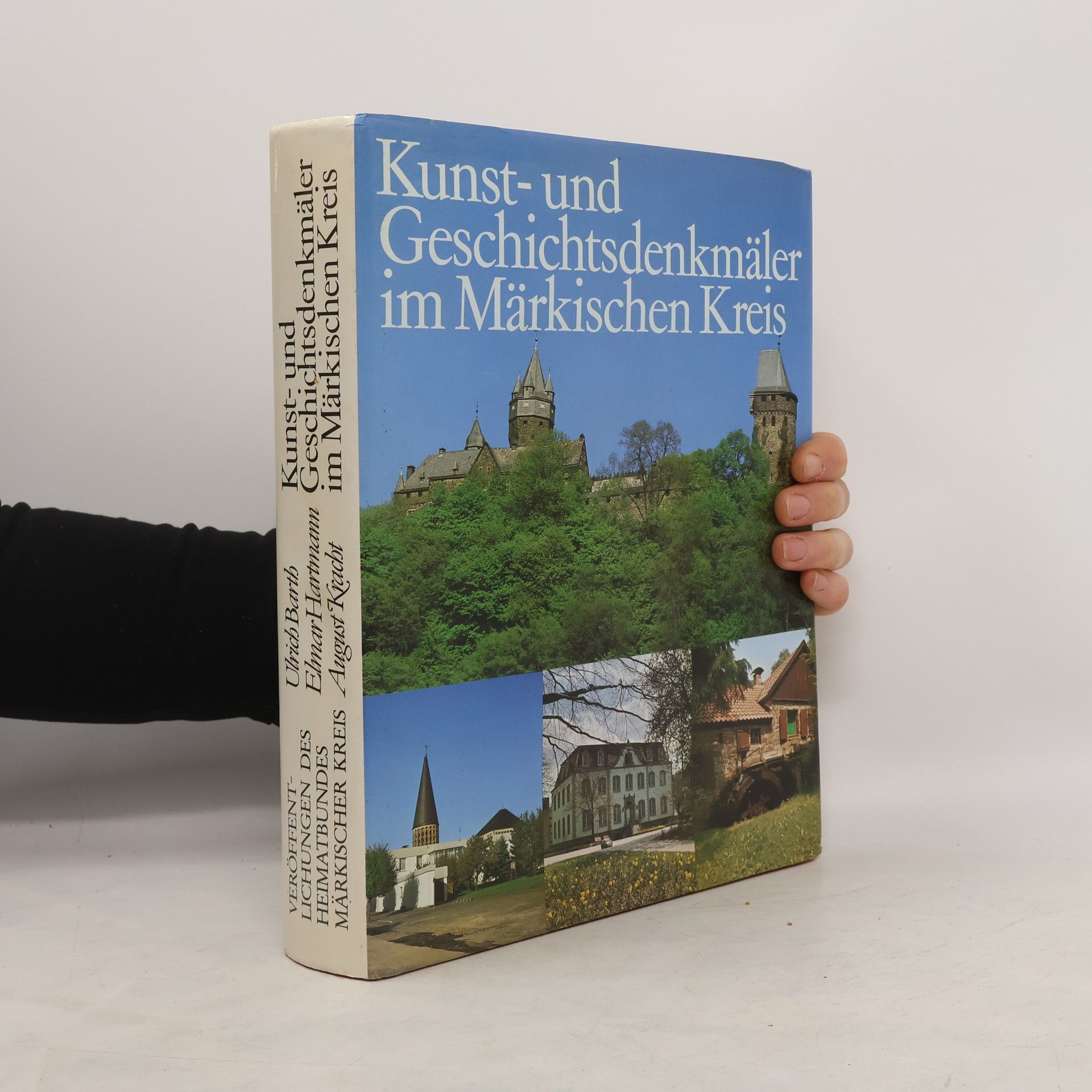Symbole des Christentums
Berliner Dogmatikvorlesung
Die Berliner Vorlesung von Ulrich Barth bietet einen innovativen Überblick über die Dogmatik, der sich auf Symbolhermeneutik des Christentums konzentriert. Anstelle traditioneller Lehrbestimmungen wird eine liberale evangelische Dogmatik entwickelt, die sowohl dem aufgeklärten Religionsdiskurs als auch der kulturellen Relevanz des christlichen Glaubens in der Moderne Rechnung trägt. Jedes Kapitel behandelt biblische Symbole, menschliche Lebenssituationen und Gottesvorstellungen, um die Verbindung zwischen Religion und Leben zu verdeutlichen. Eine kritische Analyse des Begriffs 'Dogma' bildet den einleitenden Rahmen.