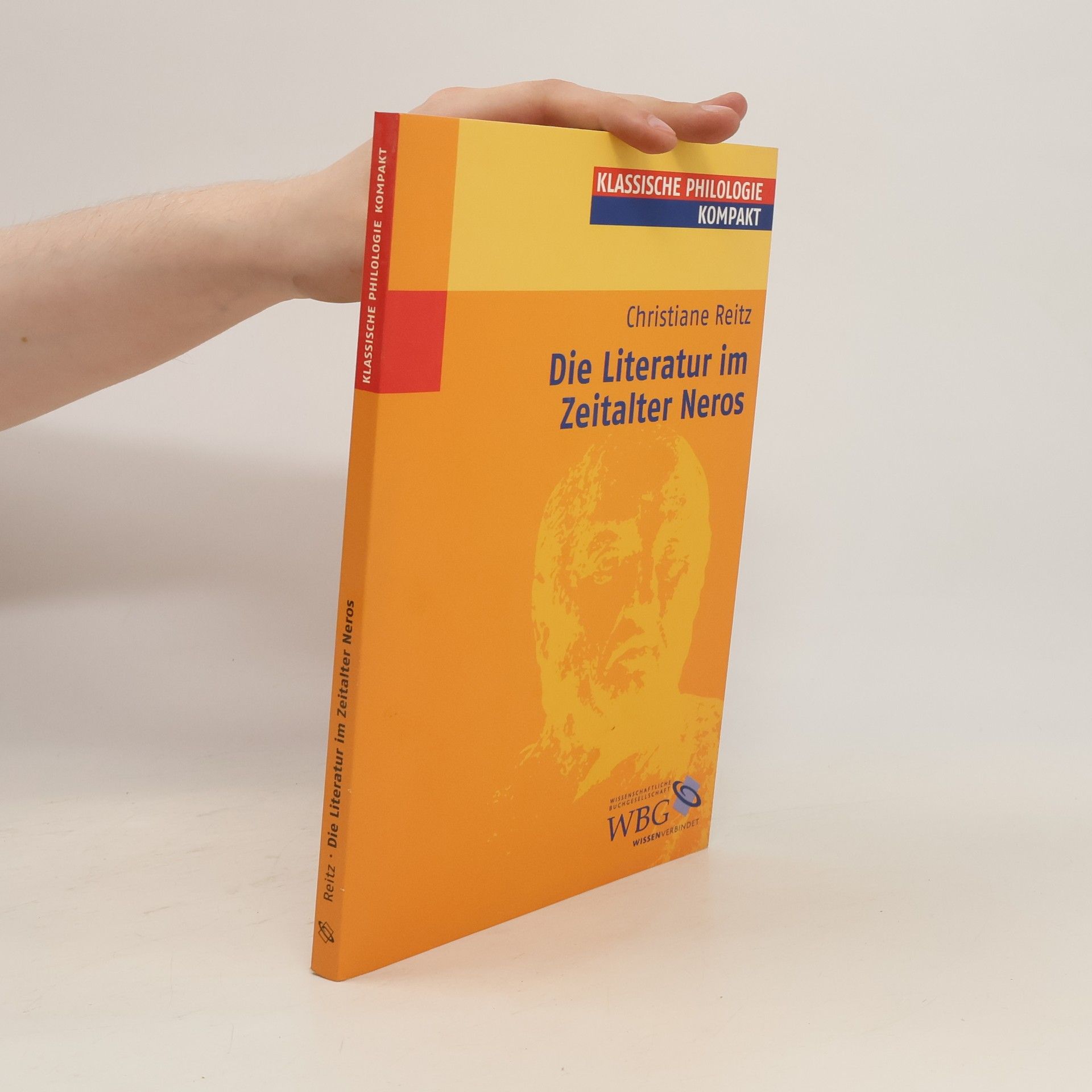Die Literatur im Zeitalter Neros
- 149pages
- 6 heures de lecture
In der Regierungszeit des Kaisers Nero (54 – 68 n. Chr.) erleben viele literarische Gattungen eine Blüte oder Renaissance. Für das Epos beschreitet Lucan neue Wege. Seneca verdanken wir die einzigen Tragödien, die aus dem römischen Altertum erhalten sind. Der Roman des Petronius stellt nicht nur ein schillerndes Sittengemälde, sondern auch ein literaturgeschichtliches Unikum dar. Die Satire erlebt mit den Gedichten des Persius einen Höhepunkt in ihrer Geschichte. Eingegangen wird u. a. auf die Fragen: Inwieweit sind die wenigen Verse, die aus Neros eigener Hand überliefert sind, für die Literatur der Epoche wertvoll? Kann unser Wissen über seine politische Entwicklung, das wir aus Sueton und Tacitus schöpfen, für die literarische Interpretation dienlich sein? Die Autorin stellt in einem Querschnitt durch die Epoche die einzelnen Autoren und Werke vor und ordnet sie in den kontextuellen Zeitrahmen ein.