Beiträge zur deutsch-französischen Geschichte - vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart von Historikern aus beiden Ländern.
Peter Schöttler Livres
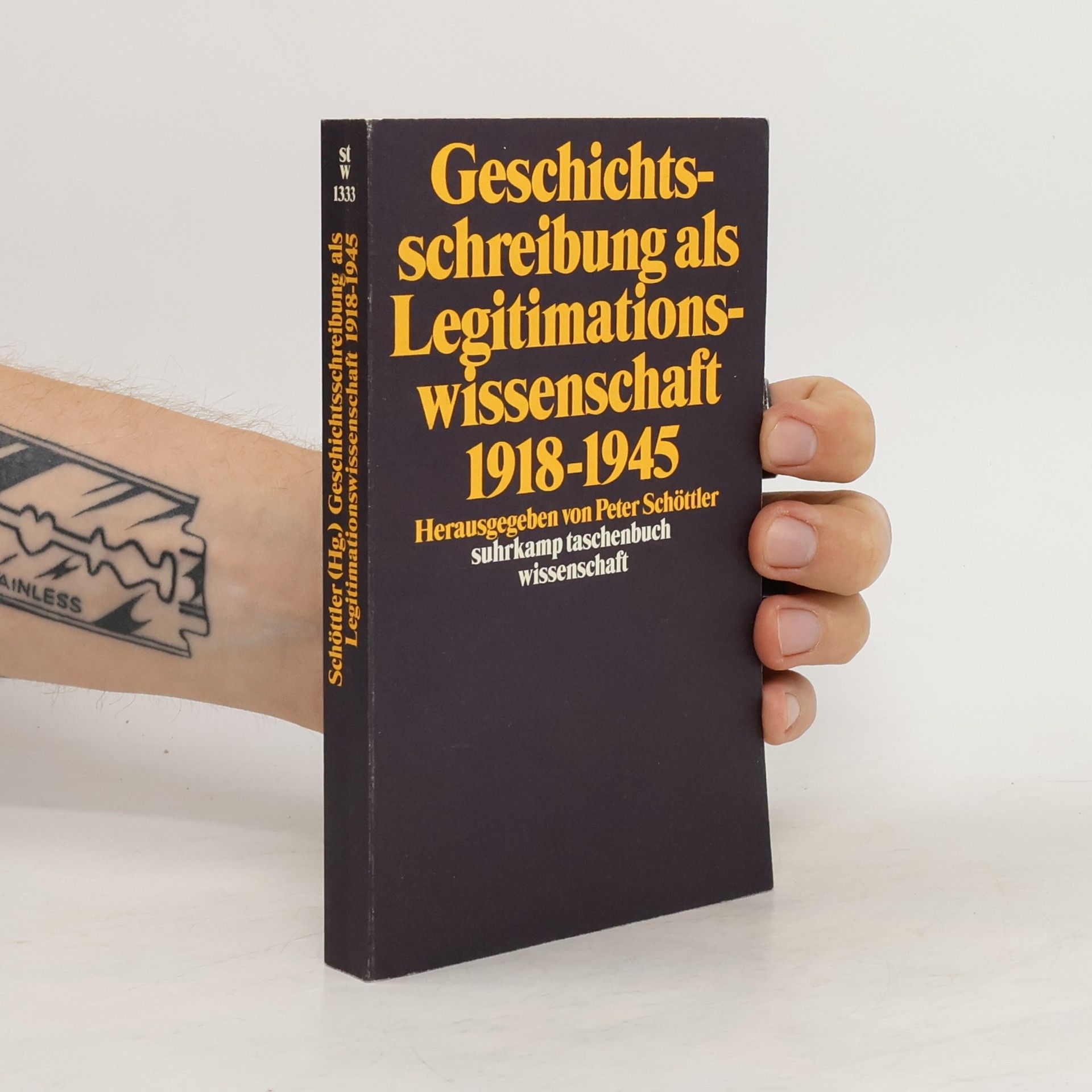
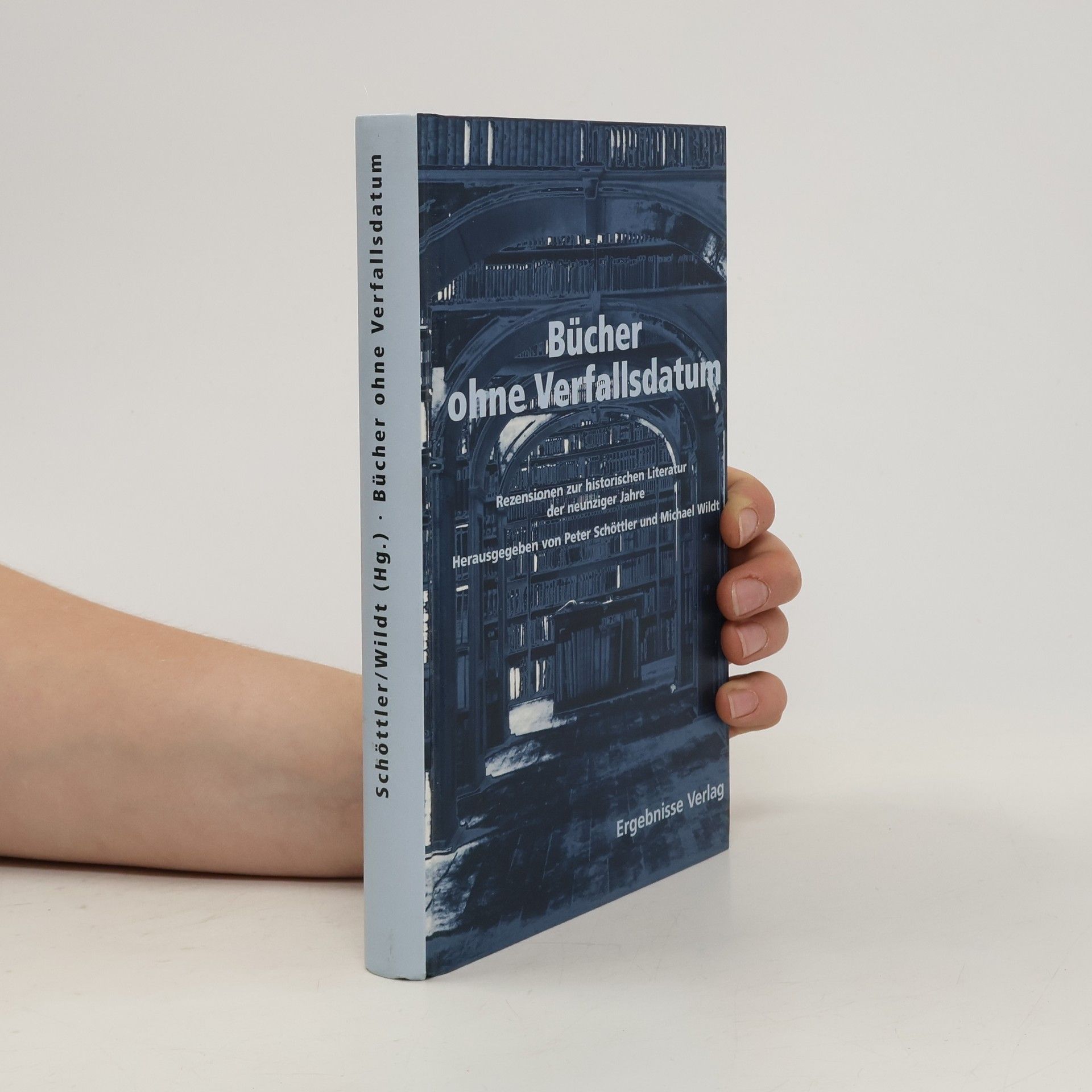

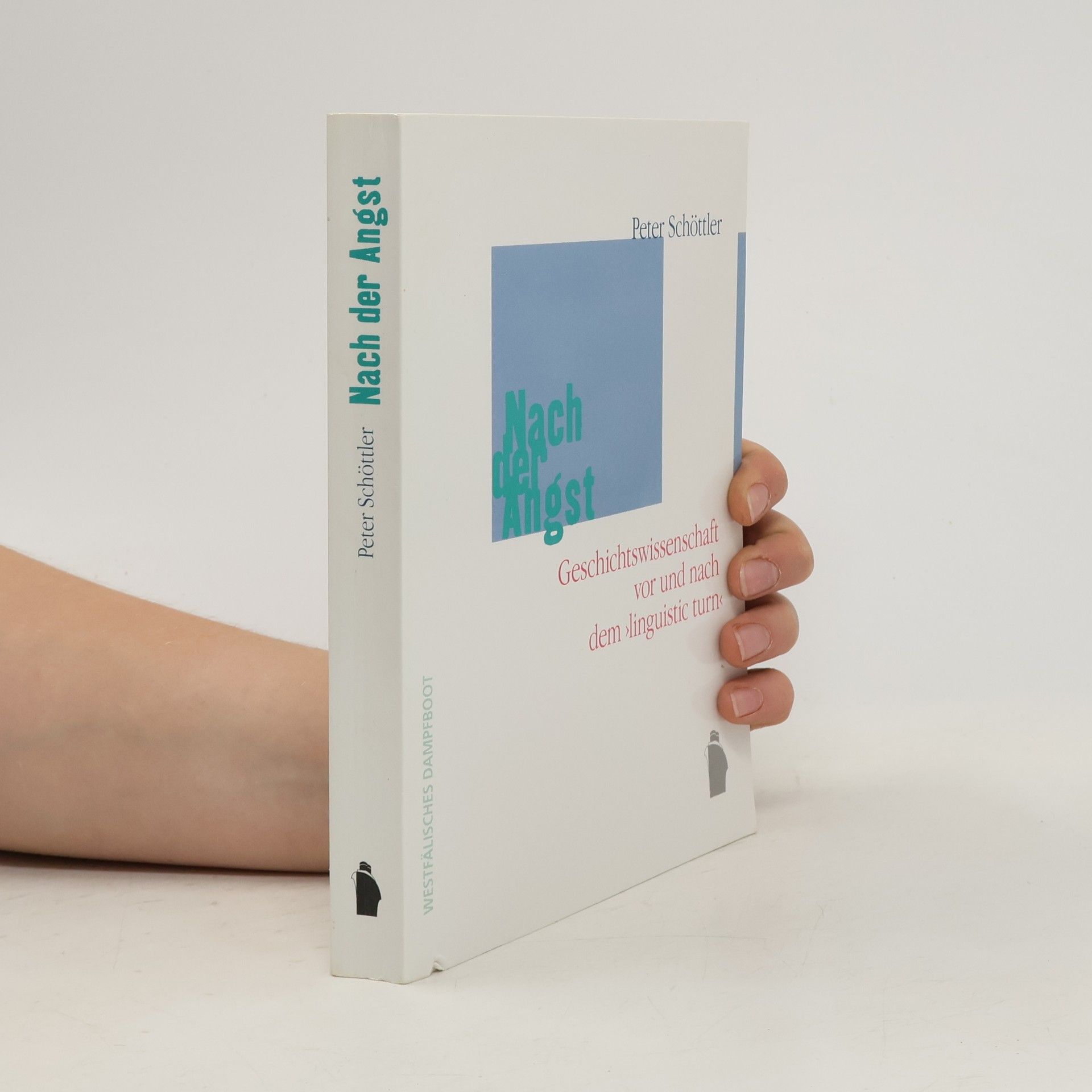
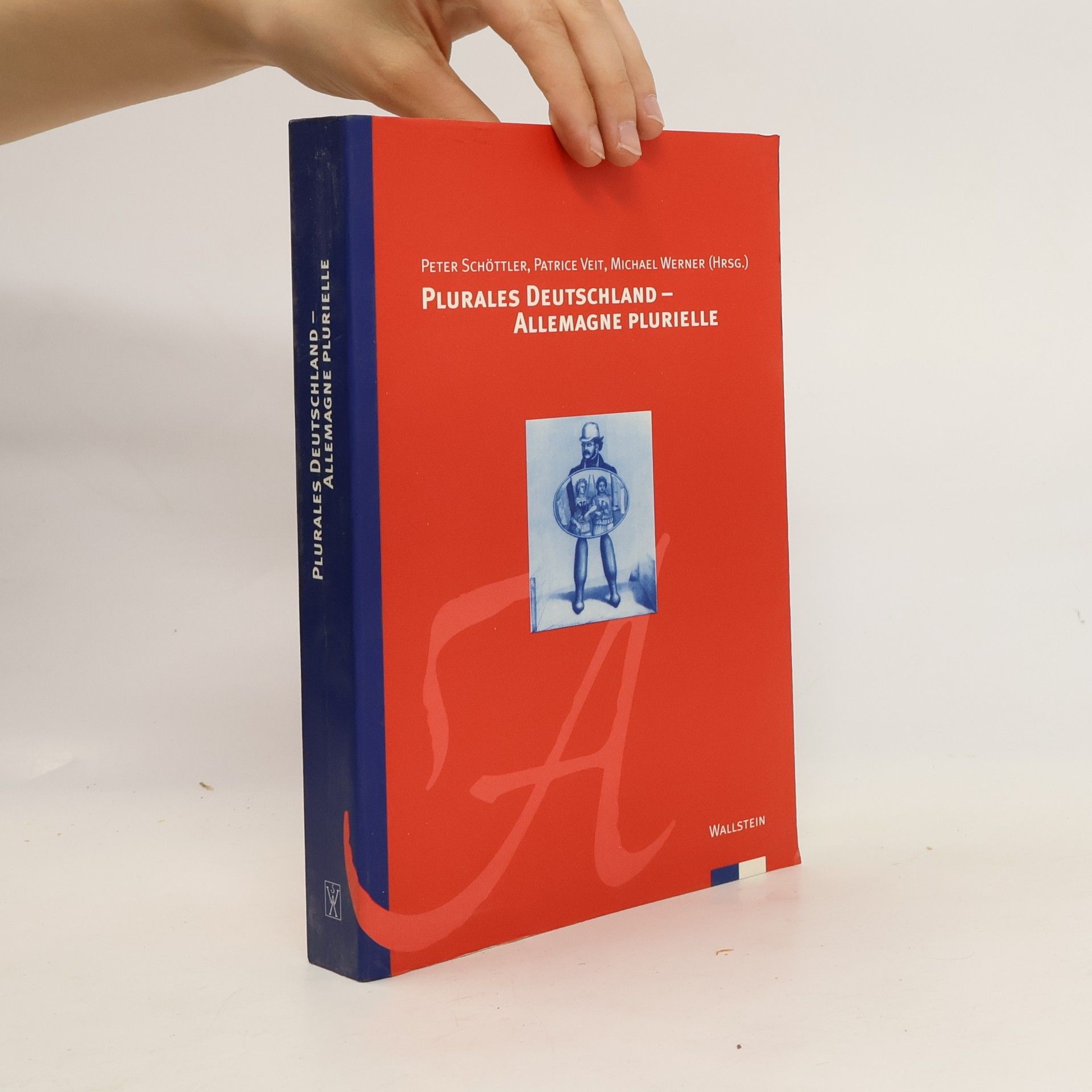
Nach der Angst
Geschichtswissenschaft vor und nach dem "Linguistic turn"
Der „Linguistic Turn“ hat den HistorikerInnen Angst gemacht: Sollte sich die Geschichtsschreibung nur noch mit „Diskursen“ beschäftigen? Stehen wir vor einem Ende der Geschichte als Sozialwissenschaft? Ist in Zukunft alles nur noch „Literatur“? In diesem Buch wird die Gegenthese vertreten: Seit dem Paradigmenwechsel zur Sozial- und Mentalitätengeschichte hat auch die Frage nach dem Stellenwert der Sprache – im Sozialgefüge wie in der Wissenschaft – eine neue Virulenz bekommen. Der v. a. von Foucault geprägte Diskurs-Begriff fungiert dabei als „Türöffner“. Sprache ist mehr als nur ein Medium der Kommunikation; sie prägt alles Denken in einer Gesellschaft, also Mentalitäten, Ideologien und Diskursformationen. Sprach- und Diskursanalysen bilden daher keine Konkurrenz zur Sozialgeschichte, sondern eröffnen ihr wichtige neue Dimensionen. Oder wie ein amerikanischer Historiker sagte: „The facts have not dissolved into discourse, but they now look different“ (Robert Darnton).
Die "Annales"-Historiker und die deutsche Geschichtswissenschaft
- 400pages
- 14 heures de lecture
Die heutige Auffassung von Historikern hat sich im Vergleich zu vor hundert Jahren durch einen wissenschaftlichen Paradigmenwechsel, insbesondere durch die „Annales“, grundlegend verändert. Diese 1929 von Marc Bloch und Lucien Febvre gegründete Zeitschrift wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zum Symbol einer nonkonformistischen, interdisziplinären Geschichtsschreibung. Der Fokus verlagerte sich von großen Persönlichkeiten, Kriegen und Diplomatie hin zu ökonomischen Interessen, sozialen Klassen, technologischen Entwicklungen und Mentalitäten. Mit dem Erfolg der „Annales“ entstand jedoch auch ein Mythos, der historisiert werden muss. Besonders wichtig ist das Verhältnis der „Annales“ zur deutschen Geschichtsschreibung. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts galt die deutsche Geschichtswissenschaft als führend, und Bloch, Febvre sowie andere Historiker der „Annales“ setzten sich intensiv mit ihr auseinander. Sie betonten, dass man angesichts von Weltkrieg und „Pangermanismus“ nicht nur „von Deutschland lernen“, sondern auch „verlernen“ müsse. Peter Schöttler, ein deutsch-französischer Historiker, untersucht in diesem Buch die komplexen, konfliktbeladenen Beziehungen zwischen französischen und deutschen Historikern, insbesondere in den Zwischenkriegsjahren und während der NS-Zeit. Der Band vereint Beiträge aus etwa fünfundzwanzig Jahren, die gegebenenfalls übersetzt und überarbeitet wurden.
Zwar deckt dieses Buch den im Titel genannten Rahmen ab, der vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zum Untergang des NS-Regimes reicht, doch der Schwerpunkt liegt eindeutig im Dritten Reich, in dem die deutsche Geschichtsschreibung - wie auch die deutsche Universität - so nachhaltig versagte. Dies zu thematisieren, also Netzwerke zu rekonstruieren, Entscheidungsprozesse aufzudecken und die Verantwortlichen beim Namen zu nennen, ist nicht allein wissenschaftlicher Selbstzweck oder eine Frage der Moral und Gerechtigkeit jenen gegenüber, die unter dem Terrorregime zu leiden hatten, die emigrieren mußten oder ermordet wurden - es ist auch eine Frage der Selbstachtung der historischen Profession.