Begegnungen
Kunstpädagogische Perspektiven auf Kunst- und Bildgeschichte
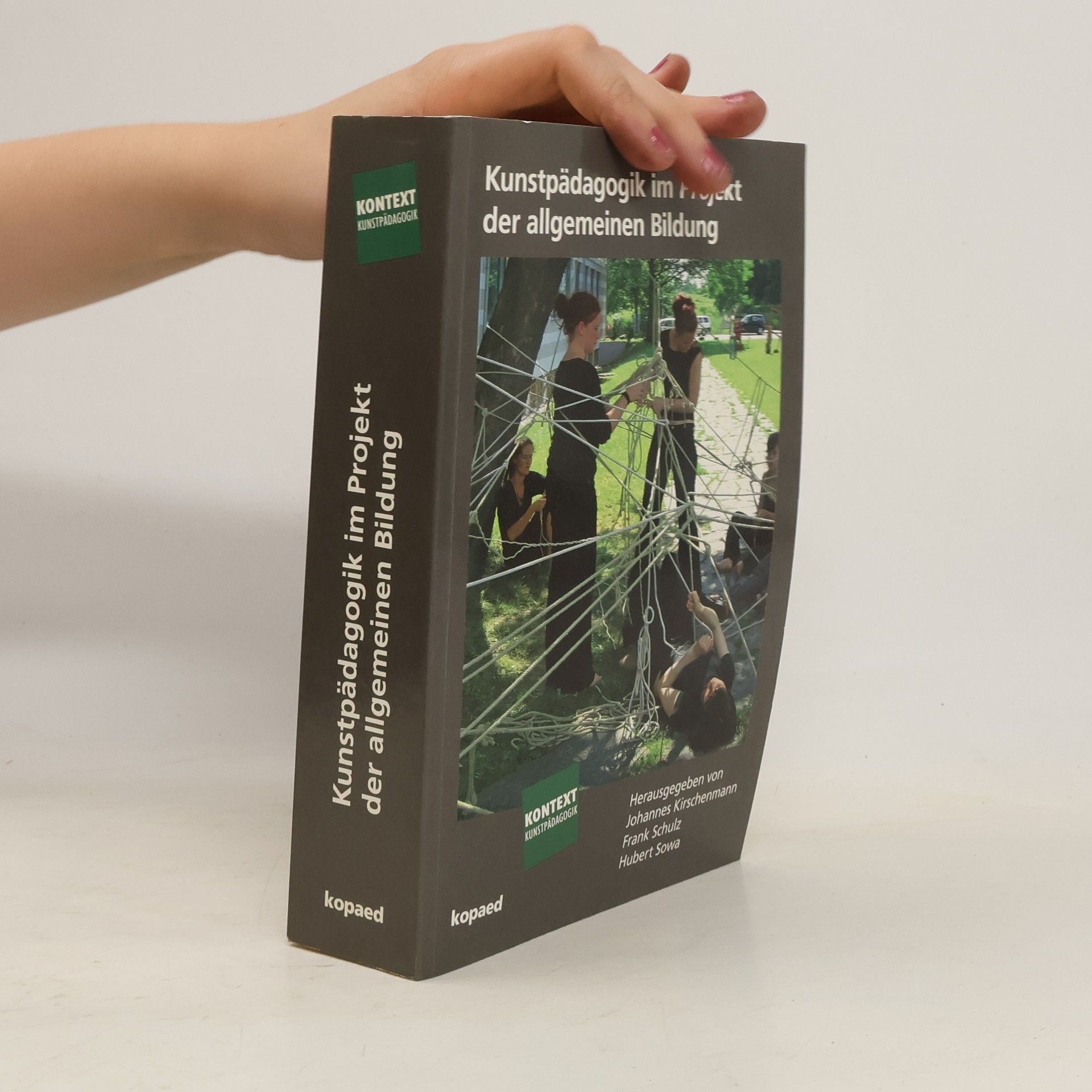




Kunstpädagogische Perspektiven auf Kunst- und Bildgeschichte
Kunst- und Bildgeschichte als kunstpädagogisches Bezugsfeld
Welt der Bilder – Sprache der Kunst
Porträt und Landschaft – abstrakt und expressiv
Die Menschheit beraubt sich in einer noch nie gekannten Dimension ihrer eigenen Lebensgrundlagen. Nirgendwo wird dies so deutlich sichtbar wie im Landschaftsbild. Die vom Menschen bedingten Veränderungen übertreffen längst das Ausmaß des naturbedingten steten Wandels. Es lohnt sich, darüber zu reflektieren: Über den Menschen, über die Landschaft. Dies geschieht in den hier gezeigten fünf künstlerischen Positionen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Was für den einen Landschaft ist, kann von einem anderen als Porträt verstanden werden, was für den einen ein Porträt ist, kann von einem anderen als Landschaft verstanden werden. Porträt und Landschaft werden zu einem möglichen, unbestimmten Territorium, in dessen abstrakten und expressiven Formen wir nach verschiedenen Botschaften suchen können. Es liegt an uns, sie zu finden. Der Katalog begleitet die Ausstellung in der Tschechischen Republik und Deutschland.
Wo steht die Kunstpädagogik? Was sind die Diskussionsfelder? Zwischen den großen kunstpädagogischen Kongressen in Leipzig (2005) und Dortmund (2007) breiten über 60 namhafte Fachvertreterinnen und -vertreter aus Hochschule und Schule sowie dem außerschulischen Bereich die aktuellen Facetten des Bildungsdiskurses in der Kunstpädagogik aus. Im Zentrum steht die Frage nach der Bildungsfunktion der Kunstpädagogik und deren unterschiedliche Begründungen zwischen dem Pol einer auf das Subjekt zielenden Bildungsidee und den poststrukturalistischen Subjektkonzepten als dem anderen Pol. Dabei treten die Debatte um Bildungsstandards, grundsätzliche Bildungsziele des Faches, die Rolle der Medien oder tradierte Fachthemen wie Kinder- und Jugendzeichnung auf die Bühne einer lebendigen, anschaulichen und auch kontroversen Auseinandersetzung. Summa summarum: Ein sehr lesenswerter Wälzer, ein komplettes Fortbildungsprogramm. Werner Stehr in Kunst+Unterricht 311/2007 Diesem Buch sind viele Leser zu wünschen - nicht nur Kunstlehrkräfte. Peter Jansen in Schulmagazin 5 bis 10, 7-8/2007