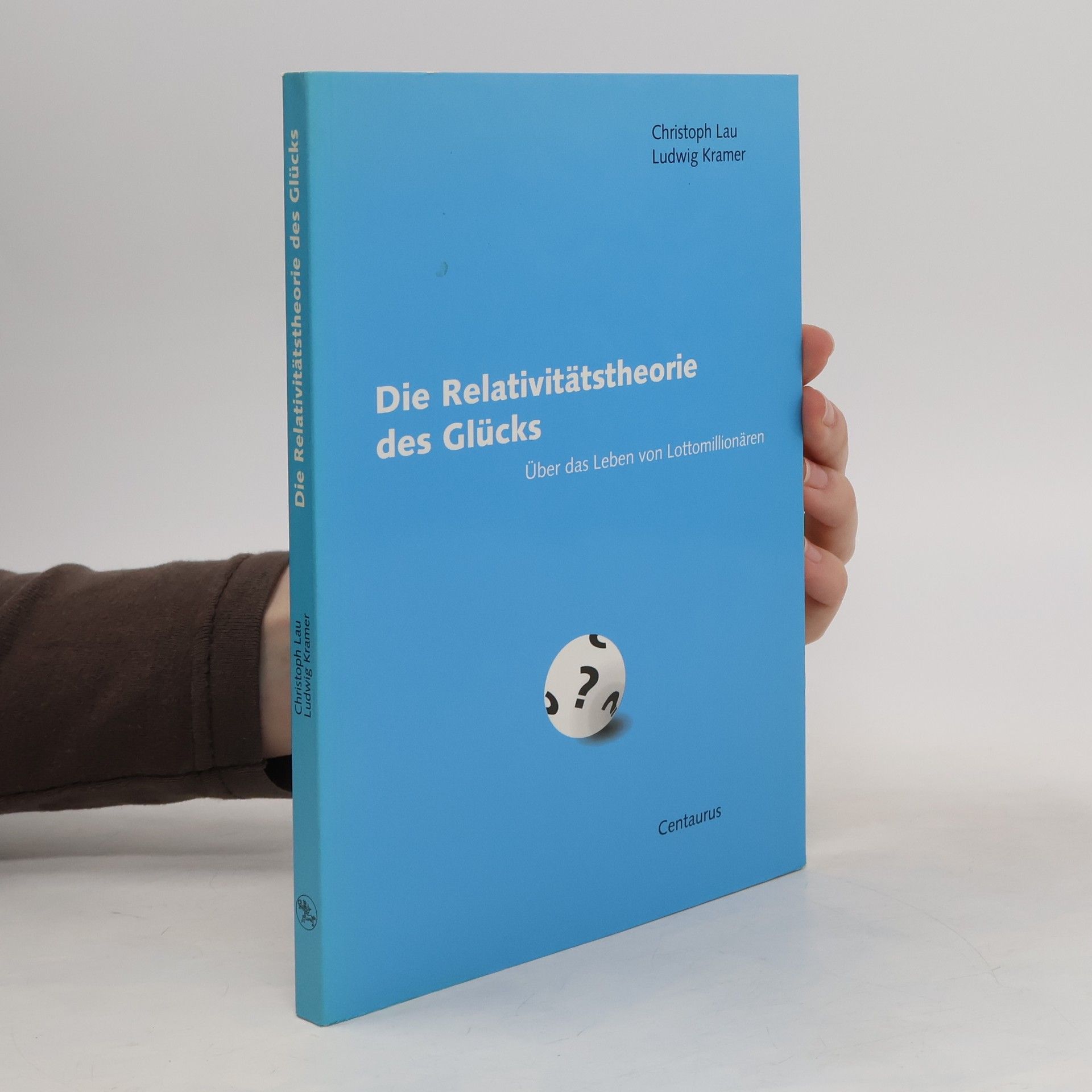Die Relativitätstheorie des Glücks
- 178pages
- 7 heures de lecture
Stellen Sie sich ein Glücksspiel vor, bei dem die Gewinnchancen extrem gering sind – selbst für kleine Gewinne liegt die Wahrscheinlichkeit unter zwei Prozent. Die Aussichten auf einen Hauptgewinn sind minimal, und es wird berichtet, dass man eher beim Kegeln stirbt. Nur die Hälfte der Spieleinsätze fließt in die Gewinnauszahlung. Dennoch nehmen Millionen Menschen in Deutschland an diesem Spiel teil und setzen jährlich über fünf Milliarden Euro ein. Woche für Woche vertrauen sie ihre Hoffnungen und ihr Glück dem Lotto an. Christoph Lau und Ludwig Kramer untersuchen die Faszination des Lottospiels und gewähren Einblicke in die oft verborgene Welt von Lottomillionären. Ungewöhnliche Zeugen des Glücks berichten von plötzlichem Reichtum, falschen Freunden und unbegrenzten Möglichkeiten. Anhand dieser Erfahrungen wird versucht, das menschliche Glück zu entschlüsseln. Die Theorien bedeutender Philosophen, von Aristoteles bis Kant, werden mit lakonischer Distanz präsentiert und fügen sich zu einer Kulturgeschichte des Glücks. Auf dieser Grundlage entstehen neue Perspektiven auf das Glück des Menschen – verblüffend, originell und intelligent. Ein Sachbuch mit literarischen Ambitionen.