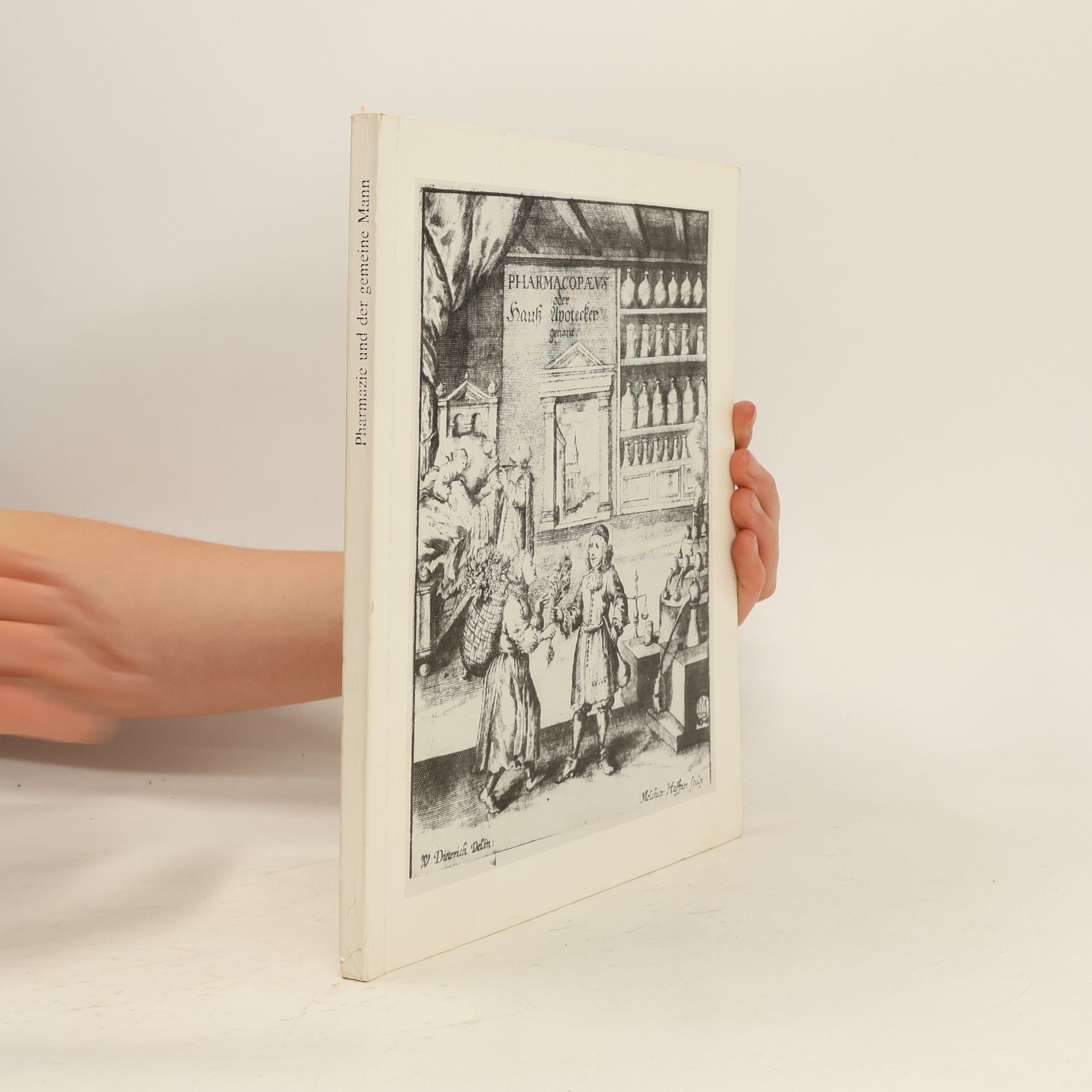Alchemie und Poesie
Deutsche Alchemikerdichtungen des 15. bis 17. Jahrhunderts. Untersuchungen und Texte
- 1094pages
- 39 heures de lecture
„Alchemie und Poesie“ behandelt deutschsprachige Alchemikerdichtungen des 15. bis 17. Jahrhunderts und bietet eine Sammlung von Studien, die seit den 1970er Jahren veröffentlicht wurden, ergänzt durch unveröffentlichte Untersuchungen und Texte. Diese gesammelten Arbeiten bilden einen einzigartigen „Alchemischen Parnaß“ in der Geschichtsschreibung zur deutschsprachigen Literatur. Basierend auf zahlreichen Überlieferungen in Handschrift und Druck, die seit Joachim Telles Forschungen an Bedeutung gewonnen haben, dokumentiert das Werk textkritisch edierte Zeugnisse, die frühneuzeitliche Interferenzen zwischen Naturkunde und Dichtung beleuchten. Es enthält etwa dreißig Texte anonymer Dichteralchemiker, die wertvolle Einblicke in die Poetisierung naturkundlichen Wissens bieten. Zudem beinhalten die Beiträge von zwei renommierten Literaturwissenschaftlern (Wilhelm Kühlmann und Didier Kahn) eine Übersicht über die Formen und Funktionen der frühneuzeitlichen Lehrdichtung im deutschen Kulturraum sowie einen Vergleich mit alchemistischen Dichtungen in anderen Sprachen. Das Werk beleuchtet bedeutende wissenschaftshistorische Konzepte der Alchemie und untersucht die inszenatorischen Dimensionen der Wissensvermittlung sowie den performativen und epistemischen Status poetisch-metaphorischer Rede in der Naturphilosophie und laborantischen Praxis.