Das Buch stellt die verschiedenen soziologischen Theorien (von Marx, Durkheim, Simmel, Weber, Parson, Luhmann und Elias) von der Differenzierung moderner Gesellschaften vor. Es will dabei vor allem die kontinuierliche Fortentwicklung dieser Perspektive seit den soziologischen Klassikern herausarbeiten und aufzeigen, daß sie unverzichtbare Einsichten zum Verständnis moderner Gesellschaften beisteuern.
Uwe Schimank Livres




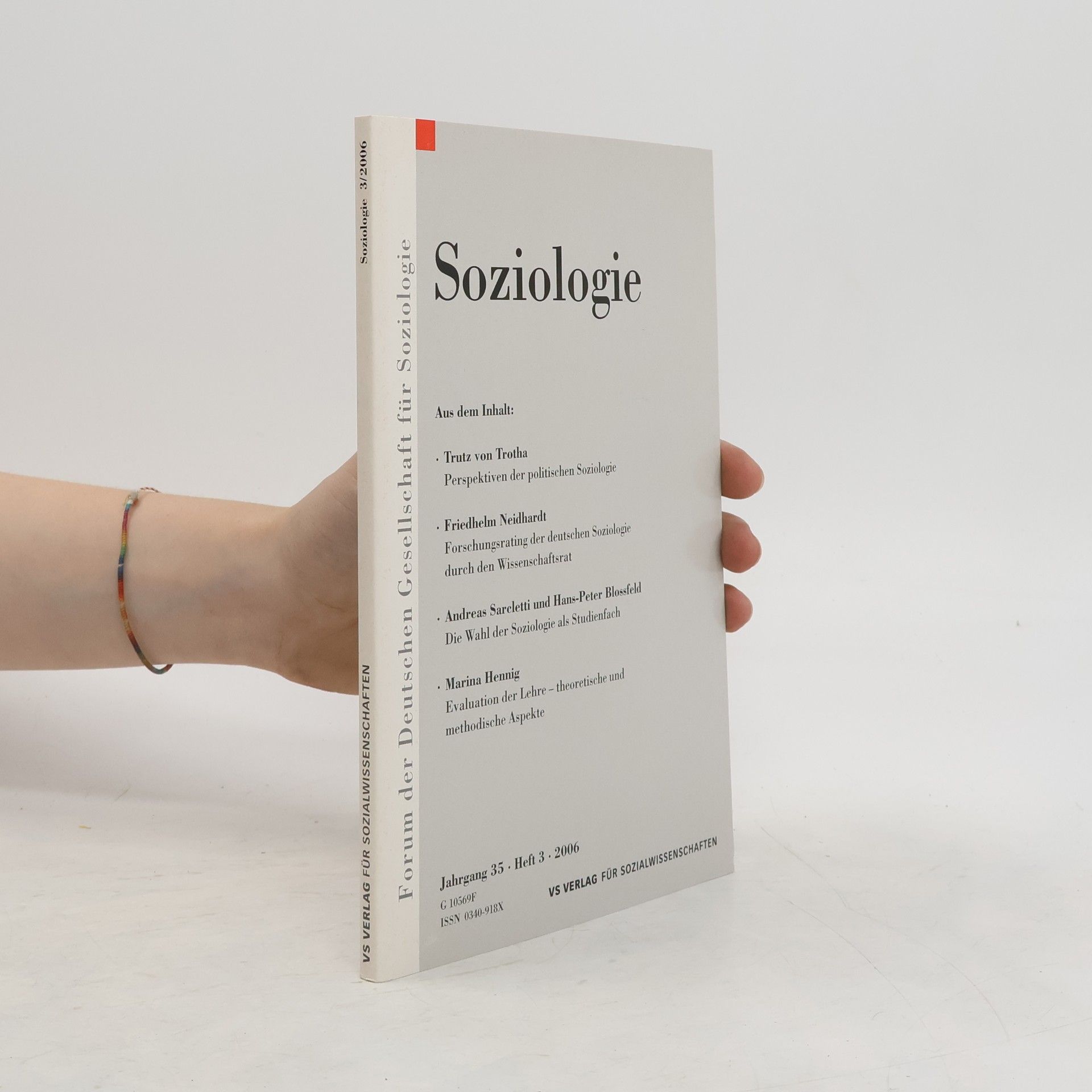
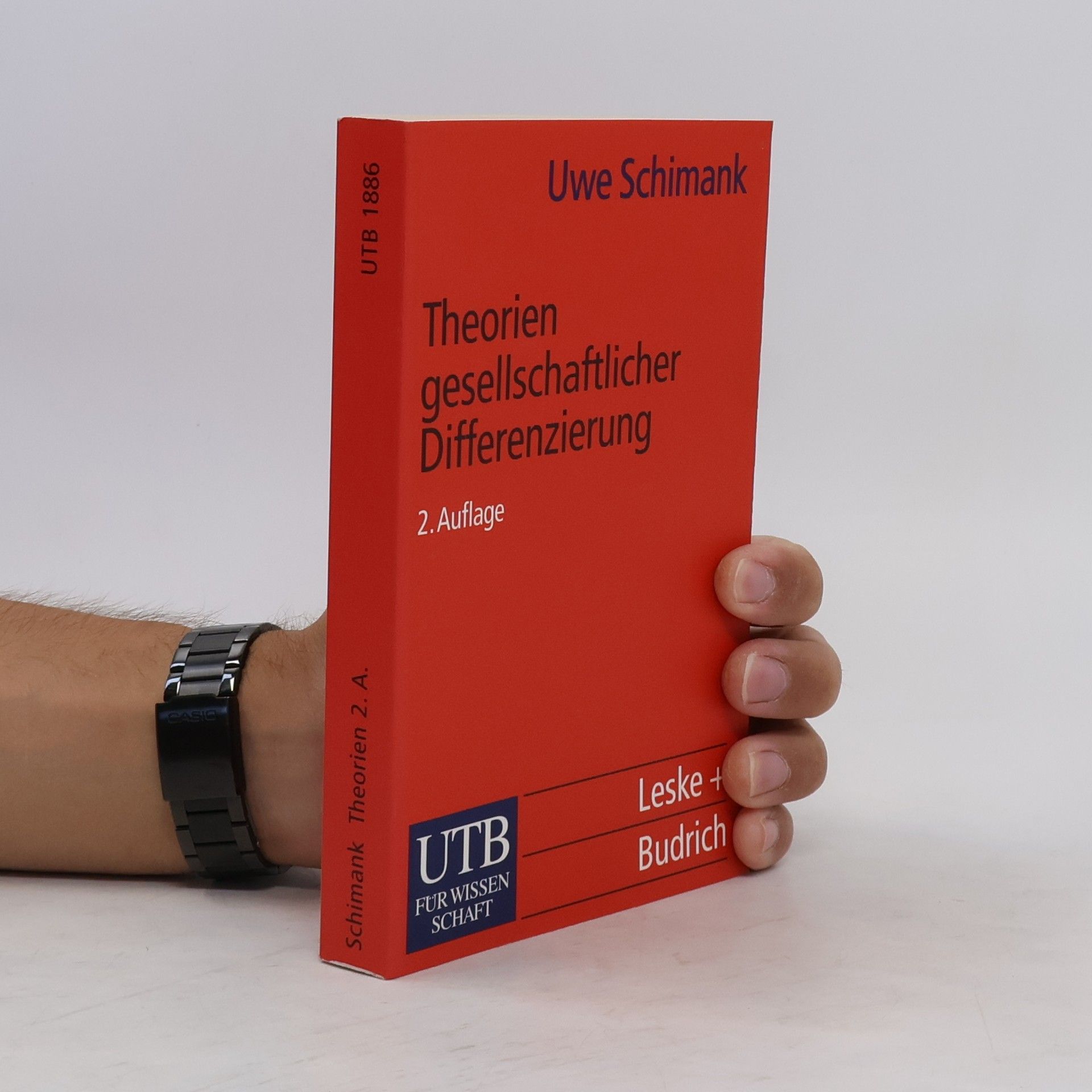
Die Autonomie der Teilsysteme der funktional differenzierten modernen Gesellschaft kann immer wieder in doppelter Hinsicht prekär werden. Teilsystemische Autonomie kann durch Einwirkungen anderer Teilsysteme gefährdet werden; und sie kann zur Verselbständigung gegenüber gesellschaftlichen Integrationserfordernissen ausarten. Politische Gesellschaftssteuerung ist einer der Mechanismen, die in der modernen Gesellschaft eine ausbalancierte Autonomie der Teilsysteme und damit funktionale Differenzierung sichern sollen. Diese Zusammenhänge von gefährdeter und gefährdender teilsystemischer Autonomie auf der einen, auf beides reagierender politischer Gesellschaftssteuerung auf der anderen Seite sind Thema der Beiträge dieses Bandes.
Entscheiden
Ein soziologisches Brevier
Die soziologische Perspektive auf Entscheidungsprozesse wird durch zahlreiche Beispiele anschaulich vermittelt. Das Buch richtet sich an Leserinnen und Leser, die vor komplexen Entscheidungen stehen, und bietet ihnen praktische Vorgehensweisen zur effektiven Entscheidungsfindung.
Beobachter der Moderne
Beiträge zu Niklas Luhmanns »Die Gesellschaft der Gesellschaft«
1997 erschien Die Gesellschaft der Gesellschaft , das gesellschaftstheoretische Hauptwerk von Niklas Luhmann. Die darin entfaltete systemtheoretische Perspektive mit ihrer Grundformel, daß Gesellschaft nicht ohne Kommunikation zu denken ist und Kommunikation nicht ohne Gesellschaft, hat seither nicht nur der Soziologie entscheidende Impulse gegeben. Die unterschiedlichen Aspekte von Kommunikation, Evolution, Differenzierung und Beobachtung, die Luhmann seiner Untersuchung abgewinnt, sowie seine Idee der Weltgesellschaft sind Gegenstand dieses Materialienbandes. Die Autoren bringen Luhmanns Gesellschaftstheorie kritisch mit anderen soziologischen Sichtweisen ins Gespräch und sind damit Zeugnis für die Aktualität und Kraft dieses Klassikers der modernen Soziologie.
Eine der spürbarsten und folgenreichsten gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte ist ein zunehmender Ökonomisierungsdruck in allen gesellschaftlichen Sphären. Dessen Ursachen, Erscheinungsformen und Folgen wird auf der Grundlage einer Betrachtung der modernen Gesellschaft als einer funktional differenzierten kapitalistischen Ordnung nachgegangen. Die Autorinnen legen eine theoretisch fundierte zeitdiagnostische Interpretation vor, die mit zahlreichen empirischen Befunden illustriert wird.
Handeln und Strukturen
- 366pages
- 13 heures de lecture
Alle sozialen Strukturen sind Produkte des Zusammenwirkens von Akteuren, seien es Individuen, Gruppen oder Organisationen. Jedes Handeln wird durch soziale Strukturen wie institutionelle Ordnungen oder die ungleiche Verteilung von Macht und Geld geprägt. Die Soziologie sieht sich zwei Erklärungsproblemen gegenüber: der Erklärung von Handlungswahlen und den Effekten des Zusammenwirkens, insbesondere der Schaffung, Erhaltung und Veränderung sozialer Strukturen. Im ersten Teil werden vier Akteurmodelle zur Erklärung von Handlungswahlen behandelt: Homo Sociologicus, Homo Oeconomicus, „emotional man“ und Identitätsbehaupter. Der zweite Teil widmet sich den strukturellen Effekten und drei Arten von sozialen Strukturen: Deutungsstrukturen, Erwartungsstrukturen und Konstellationsstrukturen, die anhand von drei Akteurkonstellationen erklärt werden: wechselseitige Beobachtung, Beeinflussung und Verhandlung. Ziel ist es, dem Leser theoretische Werkzeuge an die Hand zu geben, um soziologische Rätsel zu lösen. Der Inhalt umfasst eine Einführung in die Erklärungsprobleme, verschiedene Akteurmodelle, soziale Dynamiken und Struktureffekte sowie deren Verknüpfungen. Abschließend werden Werkzeuge und Denkstile zur Analyse von sozialen Strukturen angeboten.