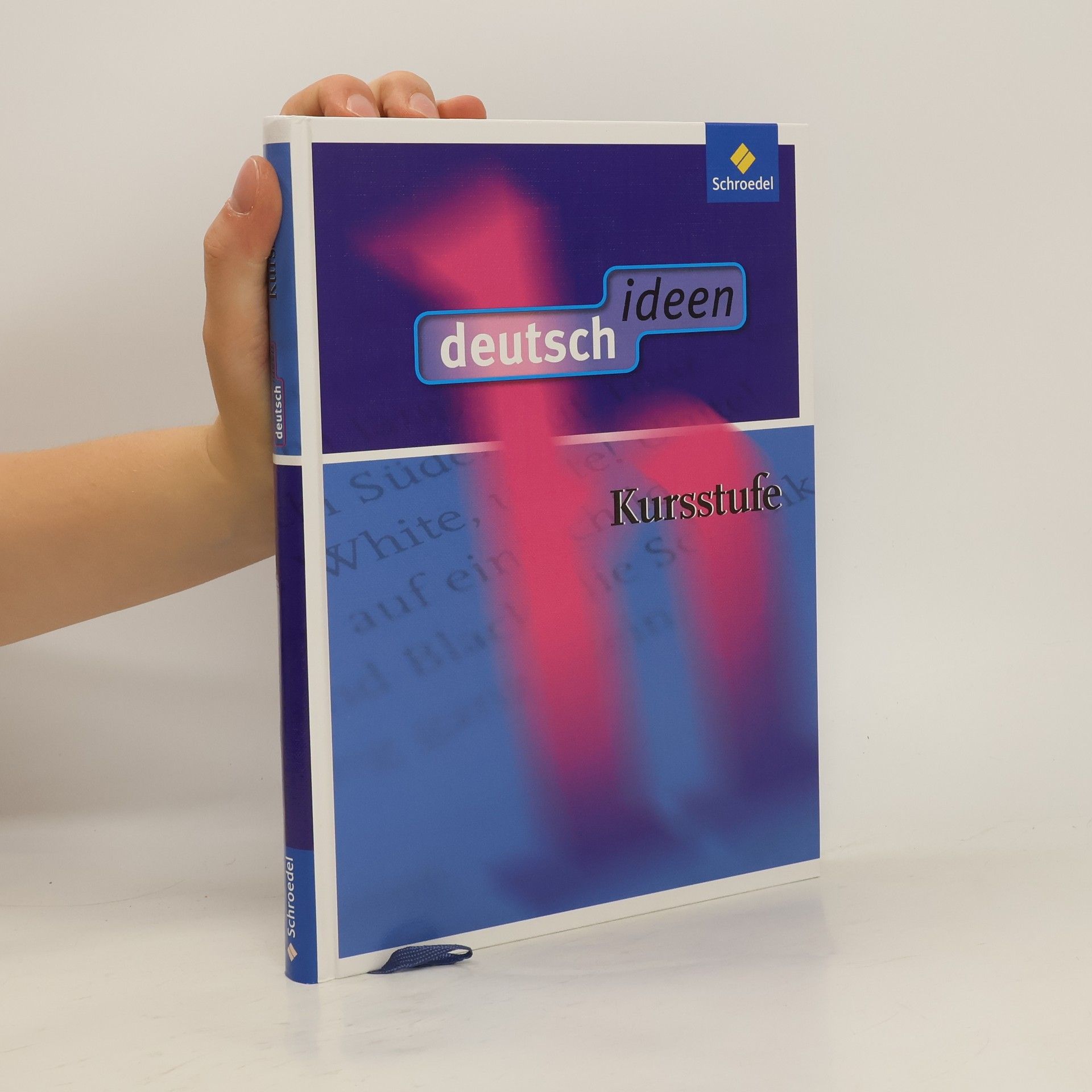Der Klärungsversuch des Theorie-Praxis-Verhältnisses im deutschdidaktischen Diskurs ist komplex und vielschichtig. Das Bild Fontanes vom weiten Feld beschreibt diese Problemsituation treffend. Die Beiträge des Bandes zeigen unterschiedliche Perspektiven: Einige Autoren sehen die Defizite in der Theorieaversion der Lehramtsstudenten, während andere das problematische Verhältnis eines Teils der Deutschdidaktik zu den Bezugswissenschaften betonen. Dabei wird kritisiert, dass die praktische Tauglichkeit fremder Erkenntnisformate zu wenig geprüft wird. Zudem werden wichtige Bezugswissenschaften wie die Neurowissenschaft vernachlässigt, die wertvolle Anregungen für eine schülerbezogene Literaturrezeption bieten könnten. Der Herausgeber bringt eine weitere Perspektive ein, indem er auf die unzureichende Reflexion des Begriffs der didaktischen Reduktion hinweist. Er identifiziert das Problem der mangelnden Integration von Gegenstands- und Schülerorientierung, was in deutschdidaktischen Studien teilweise sichtbar ist. Die Priorisierung der Gegenstandsorientierung könnte als Ausdruck einer unreflektierten Wissenschaftsgläubigkeit und eines vorherrschenden Theorie-Enthusiasmus interpretiert werden. Dadurch besteht die Gefahr, den Begriff der didaktischen Reduktion negativ zu konnotieren und ihn als wissenschaftsfern zu kritisieren. Dennoch ist didaktische Reduktion unverzichtbar für erfolgreichen Unterricht.
Günter Graf Ordre des livres (chronologique)



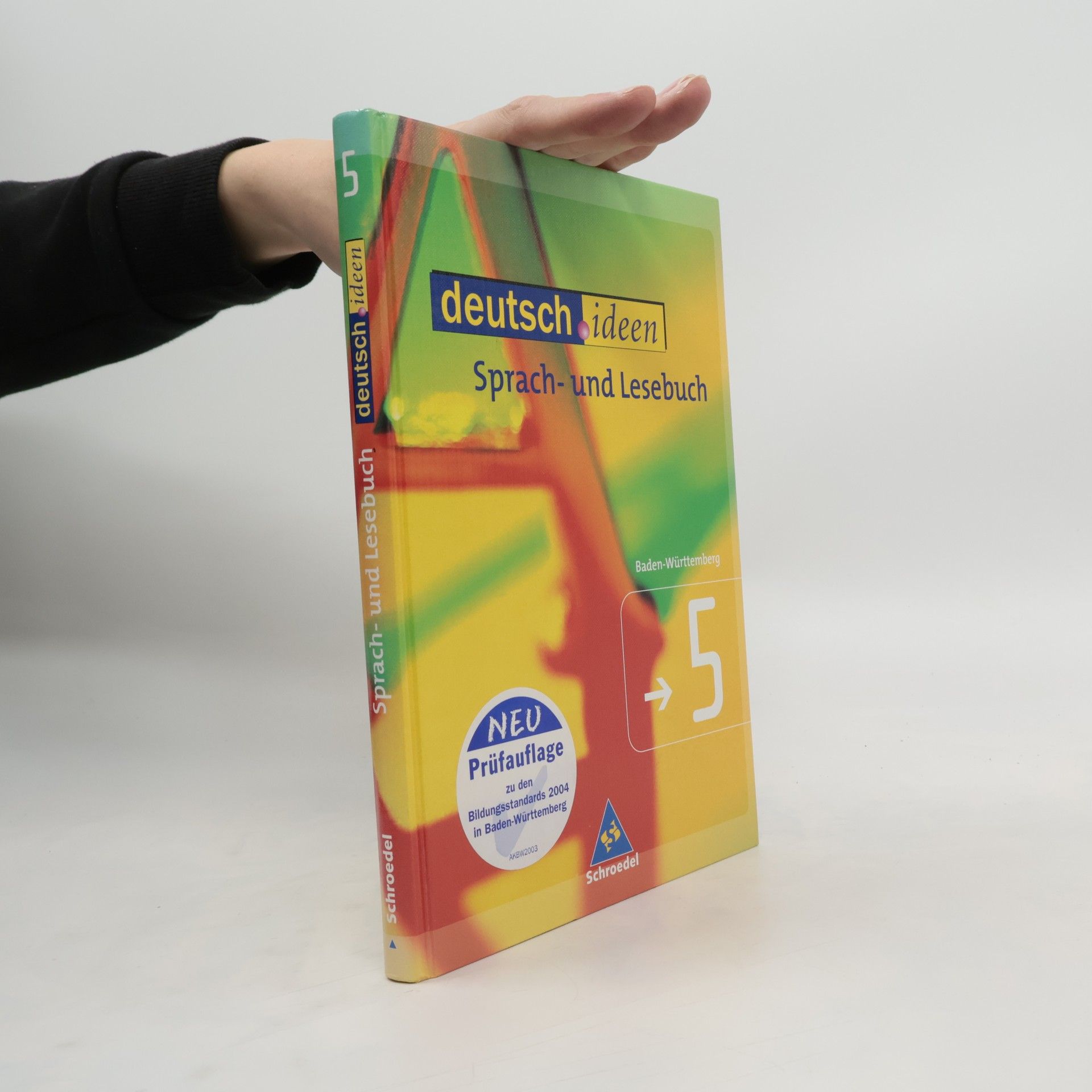


Gemeinsamer Denkstil - ein Desiderat der Deutschdidaktik
Bedeutsame Normen des Deutschunterrichts.Mit Anregungen zur Unterrichtspraxis
- 136pages
- 5 heures de lecture
Deutsch.ideen - Kursstufe
- 368pages
- 13 heures de lecture
Deutsch.ideen - Sprach- und Lesebuch
- 304pages
- 11 heures de lecture
Auf 96 Seiten haben Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, das Erlernte selbstständig zu vertiefen und zu festigen. Die ansprechende 4-farbige Gestaltung erhöht den Lernspaß und die Motivation. spezielle Arbeitsblätter zum Lernen lernen sowie zum Aufbau von Lesetechnik und Textverständnis zahlreiche Übungen zur Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik Aufgabenlösungen zur Selbstkontrolle geeignet zur Erweiterung, Vertiefung und Differenzierung
Deutsch.ideen - Sprach- und Lesebuch 6
- 327pages
- 12 heures de lecture
// Achtung: Falls auf dem Foto keine Anhänge abgebildet sind, sind diese nicht im Lieferumfang enthalten.